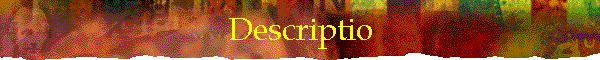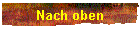
| |
PERSONARUM DESCRIPTIO
A CORPORE
2. DIE 'PERSONARUM DESCRIPTIO A CORPORE'
- Ein Abriss von der Antike bis in die Stauferzeit -
Seitdem Ernst Robert Curtius für den deutschsprachigen Raum
sein grundlegendes Werk über "Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter" 1948 vorlegte und damit, sowie mit seinen in den vorangehenden
zehn Jahren erschienenen Aufsätzen, die neuere Toposforschung begründete,(1) und
nachdem uns im französischen Sprachraum schon 1924 Edmond Faral zudem einen
Großteil des notwendigen dokumentarischen Materials über die Tradierung der
lateinischen Schulrhetorik im Mittelalter an die Hand gegeben hat,(2) begann sich
die Forschung breiter mit den Wechselwirkungen zwischen den theoretischen
Poetiken und der poetischen Praxis des Mittelalters auseinanderzusetzen.
Es ist hier nicht der Ort, das Lehrgebäude der spezifisch mal.
Spielweise der aus der Antike tradierten Rhetorik und darin der auf das
Texterstellen zielenden Poetik zu erörtern - eine reichhaltige Literatur sowie
einschlägige Artikel in Lexika halten diesen Bereich weitestgehend
aufgearbeitet zur Verfügung.(3) Zahlreiche Einzelstudien sind den Auswirkungen der
mittelalterlichen Schulrhetorik - sie war als Teil des Trivium einer der
wichtigsten Bestandteile im Curriculum des mittelalterlichen Bildungswesens -
sowie der tradierten Topoi auf die volkssprachlichen poetischen Werke des
Mittelalters gewidmet.(4)
Innerhalb des Rhetorik-Lehrgebäudes der Antike nimmt die descriptio
und v.a. die personarum descriptio a corpore gegenüber der
mittelalterlichen Ausprägung einen vergleichsweise geringen Stellenwert ein.(5)
Sowohl im griechischen, wie auch im davon abhängigen lateinischen Bereich sind
die wichtigsten genera der Rhetorik das genus iudicale und das genus
deliberativum, die Gerichts- und die Staatsrede; beides genera, in
welchen ein Redepublikum (Richter/Geschworene bzw. Volksversammlung) zur
Entscheidungsfällung über einen in der Rede dargestellten Sachverhalt
aufgefordert ist. Der Gegenstand der Rede wird ernstgenommen, ihm muss Wahrheit,
Übereinstimmung mit der Realität bescheinigt oder abgesprochen werden. Anderes
gilt für den erst in der Kaiserzeit(6) und Spätantike zu voller Blüte
entfalteten genus demonstrativum.(7) Hier nun ist der Redegegenstand nicht
mehr primär als juristisch oder legislativ zur Entscheidung aufgerufene Sache
wichtig, sondern reine Exhibition der Redekunst, d.h. die Redegegenstände sind
völlig frei wählbar. "Die Exhibition der Redekunst ist so gegenständlich
auf die Exhibition der Schönheit der Gegenstände orientiert: die Schönheit
der Gegenstände wird beschrieben und gelobt. Das Lob der Schönheit ist die
Hauptfunktion der epideiktischen Rede."(8)
In unserem Zusammenhang ist hierbei auf zwei Komponenten
hinzuweisen. Da wäre zunächst die ethische: Das Schöne, dem dialektisch das Hässliche
gegenübersteht, ist, wenn das Lob ernst gemeint ist, d.h. dem wahrhaft Schönen
gilt, auch das ethisch Gute, dem wiederum dialektisch das Böse gegenüber
steht, dem der Tadel gilt. Anders ausgedrückt ist die lobenswerte, schöne
Person stets auch ethisch vollkommen, wie die ethisch vollkommene dadurch schön
und eben lobenswert wird.(9) Die zweite, auf anderer Ebene liegende Komponente des
Zitatinhalts betrifft die potentielle Loslösung der epideiktischen Rede aus der
auf öffentliche Rede zielenden Rhetorik, d.h. den Übergang des genus
demonstrativum in die Poesie. Hier ist die Schnittstelle zwischen
ungebundener und gebundener Rede, zwischen zweckgebundener Rede und letzthin
zweckfreier Poesie; wobei das Verhältnis zwischen genus demonstrativum
und Dichtung ein wechselseitiges ist. Die Poetik, die aus der Rhetorik
erwächst, übernimmt in ihrem Emanzipationsprozess deren Techniken, wie sie
ihre tradierten Formen dieser überlässt; letztlich wird die Rhetorik zur
Poetik.(10)
Nach den Grundsätzen der antiken Rhetorik können die
Gegenstände der lobenden wie auch der tadelnden Rede Götter, Menschen, Tiere
und Unbelebtes sein. Wenden wir uns hier direkt dem Menschen zu: "Laudantur
vel vituperantur homines" und hier der Untergruppe "II) ex tempore quo
ipsi vivunt, speciatim: [...] B) ex corpore, speciatim: 1) ex pulchritudine,
describendo et enumerando singula membra."(11) In enger Verbindung zur personarum
descriptio stehen die loci a persona, nach welchen die argumenta a
persona in der Rede aufgefunden werden können, da sie bei der Analyse des
epideiktischen Personenlobs heranzuziehen sind. Der für unseren Zusammenhang
wichtige habitus corporis nimmt hierbei einen untergeordneten Stellenwert
ein.(12) Wir werden hierauf bei der Darstellung der mittelalterlichen
Rhetorik-Vorstellungen zur personarum descriptio nochmals knapp
zurückkommen müssen.
Wir sehen, dass das Lob der Schönheit einer Person, gebunden an
die Beschreibung der äußeren Schönheit des Körpers, der immer auch die hohe
innere Wertigkeit entspricht,(13) einen wenn auch kleinen, so doch fest umrissenen
Stellenwert im Lehrgebäude der antiken Rhetorik hatte.(14) Im
Trivium, dem
wichtigsten Bereich wissenschaftlicher Propädeutik der septem artes
liberales im mittelalterlichen Studienbetrieb, nahm neben der Grammatik und
Dialektik die Rhetorik die vorherrschende Stellung ein. Es lässt sich so eine
ungebrochene Traditionslinie aus der Spätantike bis in das Hochmittelalter, den
uns hier vordringlich interessierenden Zeitabschnitt des 12. und 13.Jhs, an
Schriften zur Rhetorik feststellen. V.a. Cicero und die diesem bis in die
Neuzeit zugeschriebene 'Rhetorica ad Herennium' sowie Horaz wurden zur
Errichtung der diversen mal. Rhetorikgebäude ausgeschlachtet. Wir wollen den
komplizierten Entstehungsbedingungen der Rhetoriken des Hochmittelalters nicht
weiter nachgehen,(15) sondern unser ganzes Augenmerk sogleich dem Bereich der personarum
descriptio zuwenden. Interessanterweise ist in den spätantiken und
mittellateinischen Rhetoriken die Beschreibungslehre der am breitesten
ausgebaute Bereich. Im folgenden sollen uns v.a. die um 1175 entstandene 'Ars
versificatoria' des Matthäus von Vendôme, die ca. ein Drittel ihres Umfangs
der descriptio widmet, sowie die beiden nach 1200 entstandenen Werke
Galfreds von Vinsauf, die 'Poetria nova' und das 'Documentum de modo et arte
dictandi et versificandi', quasi als Gerinnungsprodukte der praktizierten
Schulrhetorik um 1200 die Folie für die weiteren Überlegungen abgeben.(16)
In den drei genannten Werken, v.a. bei Matthäus von Vendôme,
werden uns die Techniken der personarum descriptio an die Hand gegeben,
und dieses System der Personenbeschreibung ist in seiner exakten Strenge ganz
Eigentum des lateinischen Mittelalters.(17) Wie schon für die antiken Rhetoriken
sind auch hier die locis descriptionis, die Attribute der Person wichtig:
"Sunt agitur attributa personae undecim: nomen, natura, convictus, fortuna,
habitus, studium, affectio, consilium, casus, facta, orationes."(18) Hierbei
ragen die attributa a natura heraus, die in die drei Untergruppen a
corpore, ab anima und extrinseca (a patria, ab
aetate, a cognitione und a sexu) zerfallen,(19) wobei die uns hier
vordringlich interessierende Untergruppe a corpore sehr knapp mit einem
literarischen Hinweis abgetan wird. Dieser Mangel an theoretischen Ausführungen
wird jedoch wett gemacht durch die im Rahmen der personarum descriptio
gegebenen Beispiele, unter welchen die puellae descriptio eine besondere
Stellung einnimmt.(20) Das vollständige Portrait einer Person hat zu bestehen aus
einer Erörterung ihrer Physis und ihrer moralischen Eigenschaften. Für
letztere lässt sich kein festes Modell feststellen, häufig unterbleibt diese
Erörterung auch ganz. Für die Beschreibung der physischen Qualitäten, die personarum
descriptio a corpore, lässt sich jedoch ein exaktes Muster festmachen, das
eine stets fast gleichbleibende Abfolge der Körperteile bringt.
Wie nun sieht dieses Beschreibungssystem aus? De Bruyne, Faral,
Brinkmann und Gallo haben diverse Vorläufer einer exakten Beschreibung des
Körpers, die von oben nach unten, d.h. von Kopf bis Fuß verlaufen sollte,
aufgearbeitet,(21) sie zeigen jedoch auch, dass die Striktheit des mittelalterlichen
Beschreibungssystems früheren Zeiten fremd war: "Der antik-klassischen
Periode ist ein System solcher Strenge unbekannt. Was Cicero, de inventione
(1,24ff.), was der auctor ad Herennium (IV, 49-50; effictio et notatio)
und was schließlich Horaz (Ars poetica, 144ff. und 155ff.) zur
Personenbeschreibung sagen, sind allgemeine Ratschläge und Empfehlungen, die
zwar die Ausprägung eines strengen Beschreibungssystems [...] nicht
ausschließen, aber doch auch keineswegs notwendig bedingen."(22)
Den wohl stärksten Einfluss auf die personarum descriptio a
corpore des Mittelalters hat das Theoderich-Portrait ausgeübt, das uns
Sidonius Apollinaris in seinen 'Epistulae' gibt,(23) hierauf weisen alle
neuzeitlichen Kommentatoren der mal. Rhetoriken hin. Galfred von Vinsauf gab
schon um 1200 die Anweisung: "recurrite ad secundam epistulam Sidonii, ubi
describit regem Theodoricum quantum ad habitum corporis [...]."(24)
Das Personenbeschreibungssystem, wie es sich Galfred von Vinsauf
und Matthäus von Vendôme sowie weiteren Quellen entnehmen lässt, hat folgende
Abfolge:(25)
Kopf - Haare - Stirn - Augenbrauen - Nase - Augen - Gesicht
(und Teint) - (Ohren) - Mund - Lippen - Zähne - Kinn - Nacken - Hals/Kehle -
Schultern - Oberarme - (Unterarme) - Finger - Hände - Brust (-Kasten) -
Taille - (Hüften) - (Bauch) - Beine (Oberschenkel - Knie - Unterschenkel) -
Füße.
Interessant ist an der Beschreibung des Galfred mit seinen
Vergleichsworten v.a. die Nähe zum Hohen Lied, auf dessen Beschreibungen
körperlicher Schönheit wir weiter unten eingehen werden. Die Farben Rot und
Weiß wie die zugehörige(n) Blume(n) (Rose und) Lilie, die uns auch in anderen
Beschreibungen auffallen und selbstverständlich auch der Ovid-Rezeption
entstammen können, und weitere Bilder und Vergleiche weisen in diese Richtung.
Als zweites ist interessant, wie er im Zusammenhang der expliziten
Frauen-Schönheits-Beschreibung nach der Taille die Partie des Unterleibs beredt
verschweigt: "Taceo de partibus infra:/Aptibus hic loquitur animus quam
lingua."(26)
Diese personarum descriptio a corpore mit ihrer hier
nicht weiter ausgeführten Bildersprache - und in diesem Bereich variieren die
Beschreibung des Mannes und die der Frau nochmals - ist in Vollständigkeit in
der volkssprachigen Literatur des Mittelalters selten zu finden. Wichtigster
Bestandteil ist die Beschreibung des Kopfes, da sich nach mal. Doktrin aus der
Physignomie des Gesichtes der Seelenzustand des beschriebenen Menschen ablesen lässt.(27)
Der Hauptunterschied der Körperbeschreibung zwischen den Geschlechtern ist
darin zu sehen, dass beim Mann die Stärke und der Mut durch sie unterstrichen
werden soll, bei der Frau jedoch die den inneren Werten korrespondierende
äußere Schönheit - mit den aus dem Blickwinkel des Mannes zur weiblichen
Schönheit unbedingt wichtigen Körperteilen - im Vordergrund steht.(28) Von hier
aus ist zu verstehen, warum die personarum descriptio in der Literatur
des Mittelalters v.a. im Hinblick auf die junge, schöne, mit körperlichen
Reizen reich ausgestattete Frau große Wichtigkeit erlangte.
Mit Sicherheit ist die hier dargestellte Bedeutung der
Körperbeschreibung nicht ohne Wirkung auf die profane, volkssprachige Literatur
des Mittelalters geblieben,(29) sei es, dass die Autoren selbst eine die Rhetorik
umfassende Bildung genossen haben - für Hartmann von Aue und Gottfried von
Straßburg ist dies anzunehmen -, sei es, dass der Kontakt mit der mlat. Lyrik
rhetorisch geschulter Kleriker oder fahrender Scholaren Vorbildfunktion für das
eigene Schaffen gehabt hat.(30) Es ist dies jedoch keineswegs die einzige Quelle,
aus welcher die Autoren mhd. Personenbeschreibung in Epik oder Lyrik ihre Muster
bezogen haben können.
Anmerkungen
-
Vgl. Curtius (1948/1967);
ders. (1938,1); ders.
(1938,2); ders. (1941,1); ders. (1941,2); ders. (1949).
Siehe auch die Beiträge in den Sammelbänden:
Bäumer (1973); Jehn (1972), hier S.320-348 breite biographische Angaben.
Kritisch zum Curtiusschen Topos-Begriff z.B.:
Mertner (1956) S.178-224. Vgl. auch den Versuch von Bornscheuer (1976), die
Topik wieder von der Gründung in Aristoteles her in einen neuen soziologischen,
gesellschafts- und ideologiegeschichtlichen Gesamtzusammenhang zu stellen; hier
S.138-149 eine kritische Darstellung des Curtiusschen Toposbegriffs sowie
S.149-158 des kritisch-erweiternden Ansatzes von Mertner.
-
Vgl. Faral (1924); hier auch weitere ältere
Literatur zur Rhetorik-Rezeption des Mittelalters und deren Einfluss auf die
romanische volkssprachige Literatur.
Wichtige Quellen zur spätantiken und mal.
Rhetorik auch in: Halm (1863).
-
Verwiesen sei hier als Standardwerke auf:
Lausberg (1973) 2 Bde; Curtius (1967); de Bruyne (1946) 3 Bde, v.a. Bd.3;
Brinkmann (1928) v.a. S.29-81; ders. (1980). Vgl. auch die Beiträge in: Murphy
(1978) v.a. S.3-142 über die rhetorischen Theorien des Mittelalters.
-
Vgl. für die
mhd.Literatur, z.B. zum
Natureingang im Minnesang: Wulffen (1963); zum locus amoenus: Thoss (1972); zur
poetischen Technik des frühen Minnesangs: Grimminger (1969); zum Verhältnis
Gottfrieds von Straßburg zur Poetik: Sawicki (1931), in diesem frühen Werk auf
S.13-55 ein knapper aber profunder Abriss der rhetorisch-poetologischen
Tradition im Mittelalter.
Kuhn (1985) hat kürzlich anhand der
Prolog-Technik mal. Epiker und der darin behandelten Literaturauffassungen
Anregungen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Dialektik zwischen
traditionsgebundener Rhetorik-Rezeption und je unterschiedlicher dichterischer
Eigenleistung gegeben. Hier S.7-24 eine Hinführung zum Spannungsverhältnis
"antike Rhetorik" versus "christliche Ästhetik";
reichhaltige Literaturhinweise!
-
Vgl. zum folgenden v.a.: Lausberg (1973) §239ff
u.§810ff; Lausberg gibt hierbei jeweils die antiken Autoren an, auf welche sich
seine rhetorischen Theoreme beziehen.
-
Zum möglichen Einfluss der griechischen
jüngeren Sophistik auf die Rhetorik der Kaiserzeit und damit mittelbar auch auf
das Mittelalter vgl.: Brinkmann (1928) S.65-68.
-
Selbstverständlich ist die epideiktische Rede
immer schon auch Bestandteil des genus iudicale (und in etwas geringerem
Maß des genus deliberativum) gewesen, denn das argumentum a natura,
das die qualitates animi et corporis erörterte, wurde hier naturgemäß
zur Überzeugung eingesetzt.
-
Lausberg (1973) §239, S.130.
-
Vgl. schon: Aristoteles, Rhetorik 1366a; (1980)
S.47.
-
Vgl. Curtius (1967) S.79:"wir sahen [...],
daß die Lobrede zu einer Lobtechnik wurde, die sich auf jeden Gegenstand
anwenden ließ; daß auch die Poesie theoretisiert wurde. Das bedeutet nichts
anderes, als daß die Rhetorik ihren ursprünglichen Sinn und Daseinszweck
verlor. Dafür drang sie in alle Literaturgattungen ein. Ihr kunstvoll
ausgebautes System wurde Generalnenner, Formenlehre und Formenschatz der
Literatur überhaupt."
-
Lausberg (1973) §245.
-
Vgl. Lausberg (1973) §376; neben genus,
nation, patria, sexus, educatio et disciplina, fortuna, studia, animi natura
u.a., d.h. auf Herkunft, Geschlecht, Erziehung, Lebensverhältnisse und
Seelenzustand bezogene loci auch als 7.locus der habitus
corporis.
-
Dies kommt v.a. in Kommentaren zum Hohen Lied
immer wieder zum Ausdruck, vgl.: de Bruyne (1946) Bd.3, S.36f.
-
Zur Prunkrede und ihrer Bedeutung in der Antike
und ihrer Auswirkung auf das Mittelalter vgl.: Curtius (1967) S.78f, 163-168
u.ö.
-
Vgl. die Aufarbeitungen in: Sawicki (1932)
S.13-55; Faral (1924); de Bruyne (1946); Curtius (1967) v.a.S.27-88 u.435-461.
Siehe auch die bei Curtius (1967) S.58-64
gegebenen Listen der mal. Schulautoren, v.a. die im 'Laborinthus' Eberhards des
Deutschen aufgeführten: Faral (1924) S.358ff.
-
'Ars versificatori', 'Poetria nova' und
'Documentum'
ediert in: Faral (1924) S.109-193, 197-262, 265-320. 'Poetria nova' jetzt auch
in: Gallo (1971) S.14-129 (mit engl. Übersetzung).
-
Vgl. Brinkmann (1928) S.52: "Wandel von
Beweglichkeit [antik] zu größerer Starrheit [mal.]." "Eine stengere
Regelung wird vollzogen."
-
'Ars versificatoria' I.77. S.o.Anm.19.
-
'Ars vers.' I.79-82.
-
Vgl. 'Ars vers.' I.38-59. Siehe zur Wirkung auf
die mlat.Liebesdichtung: Brinkmann (1925) S.90-93.
Vgl. zu alledem stets: 'Poetria nova' V.559-672
(Zählung nach Gallo (1971), die geringfügig von Faral (1924) abweicht).
-
Vgl. de Bruyne (1946) v.a. Bd.1, S.287ff u.Bd.2,
S.173ff; Faral (1924) v.a. S.79ff; Brinkmann (1928) S.54ff; Gallo (1971)
S.177-187.
-
Baehr (1956) S.124f.
-
Vgl. Epistulae I,2 §2 (MGH
Auct.ant.VIII, S.2f),
in: Faral (1924) S.80f; strenge Abfolge von oben nach unten mit genauer
Benennung der einzelnen Körperteile.
-
'Documentum' II,10.
-
Ich halte mich hier an die Reihung nach Galfreds
'Poetria nova' V.568-602, da dieser in V.567 ausdrücklich auf die Beschreibung
weiblicher Schönheit abhebt - und diese interessiert uns hier ja besonders.
Vgl. Gallo (1971) S.185.
Die von Faral (1924) S.80 gegebene Reihenfolge
der Beschreibung, die Leube-Fey (1971) S.20 übernimmt, und die von Baehr (1956)
S.124 anhand des provenzalischen Versromans 'Flamenca' V.1583-1620 aufgestellte
weichen von der Galfreds nur in wenigen Punkten jeweils ab, die Positionen in
Parenthesen sind aus diesen Reihungen ergänzt. Vgl. auch die von Brinkmann
(1925) S.90-92 gemachten Anmerkungen.
-
'Poetria nova' V.599f. Übers: "Ich schweige
von den Gegenden die darunter folgen: hierüber weiß die Vorstellung/Seele
besser zu sprechen als die Zunge."
-
Vgl. de Bruyne (1946) Bd.3, S.36 zur
etymologischen Auslegung des Hohen Liedes durch Honorius von Autun [d.i.
Honorius Augustodunensis, vgl. Ohly (1958) S.251f/Anm.6]: "Une troisième
définition etymologique nous remet elle aussi en plein tradition : 'Decorus
dicitu quasi decor oris: per faciem, enim homo cognoscitur'. Le visage
est la synthèse de l'Homme, c'est aussi par lui que s'exprime l'âme."
-
In der von Baehr (1956) analysierten
'Flamenca'-Stelle
wird das Äußere des Helden Wilhelm von Nivers beschrieben. Dass hier die
Ober-, Unterarme ;und Schultern ;(stark wie Atlas), die Seiten des mächtigen
Brustkastens ;sowie die Hüften;, Ober- und Unterschenkel ;mit Knie ;besonders
erwähnt werden, ist von dieser Funktion her nicht verwunderlich.
-
Für den romanischen Bereich haben Baehr (1956)
und Leube-Fey (1971) die Wirkung aufgearbeitet. Für die mlat., romanische und
deutsche Lyrik des MAs gilt noch immer vorbildlich: Brinkmann (1928); sowie aus
neuerer Zeit z.B.: Dronke (1968) 2 Bde.
-
Die Texte der 'Carmina
Burana' zeigen
beispielsweise, in welch hohem Maß das Schulwissen, zu dem neben theoretischen
Schriften auch die Lektüre antiker Autoren (z.B. Vergil, Horaz und v.a. Ovid)
gehörte, Eingang in die mlat. Lyrik gefunden hat. Brinkmann (1925) S.92f weist
auf diesen engen Bezug in Einzelheiten hin. CB 67 und 156
|