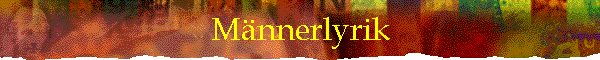
|
|
|
|
Minnelyrik= Männerlyrik
1. MINNELYRIK ALS TRIEBSUBLIMIERTE MÄNNERLYRIKMinnelyrik, diese spezifische Form der mittelhochdeutschen Liebeslyrik, ist reine Männersache - dies will heißen, dass sie ihrem Wesen nach Aussagen von Männern über die Liebe vereinigt. Man mag gegen diese Bestimmung halten, dass eines der ersten Liebesgedichte mhd. Zunge wohl vordergründig einer Frau in den Mund gelegt ist: Dû bist mîn, ich bin dîn. Der Kontext, in dem dieser kleine Text überliefert ist, die lat. Musterbriefsammlung der Tegernseer Hs. des 12.Jhs, lässt eine weibliche Verfasserin jedoch zumindest zweifelhaft erscheinen. (1) Zudem fehlt diesem Text der für Minne-Lyrik allgemein als wesentlich erachtete Faktor der Distanz, es handelt sich hier vielmehr um ein echtes Liebesgedicht. Auch noch der eine oder andere der in MF versammelten Texte wurde mit mehr oder weniger gewichtigen Gründen in der älteren Forschung einer dichtenden Frau zugeschrieben. (2) Überblicken wir jedoch den gesamten uns hier interessierenden Zeitraum der mhd. Liebeslyrik des 12. und 13.Jhs, so gilt das oben Postulierte wohl voll und ganz, v.a. wenn wir die namentlich überlieferte Lyrik ins Auge fassen. (3) Vollends gilt dies, wenn wir uns dem eigentümlichen Phänomen der Minnelyrik, dieser spezifisch mittelalterlichen Ausprägung einer männerbezogenen Liebeslyrik zuwenden. Höfische Liebe, die das Thema der Minnelyrik darstellt, ist kaum ein Phänomen der höfischen Wirklichkeit als vielmehr ein rein ästhetisches, ein Phänomen der höfischen Kultur, die in der volkssprachigen Belletristik ihr adäquates Ausdrucksmittel gefunden hat. (4) Zentrum der Minnelyrik des uns hier interessierenden Zeitraumes ist somit auch weniger das reale Verhältnis Mann - Frau als die Reflexion über die gefühlsmäßigen und gedanklichen Prozesse im Mann selbst, die durch dieses idealisierte Verhältnis ausgelöst werden. Sei es, dass dies in Reflexionslyrik stärker theoretisierend abgehandelt wird, z.B. bei Friedrichs von Hausen Waz mac daz sîn, daz diu werlt heizet minne (MF 53,15ff) oder Walthers von der Vogelweide Aller werdekeit ein füegerinne (L 46,32ff); sei es, dass in Formen des distanzierten Wechsels, in Dialogen oder gar des inneren Monologs einer Frau, wie in Friedrichs von Hausen Wol ir, si ist ein saelic wîp (MF 54,1ff) oder in Walthers Under der linden (L 39,11ff), der Frau die Phantasmagorien des Mannes - an Erlebnislyrik gemahnend - in den Mund gelegt werden. Stets ist es der Mann, der seine Reflexion über die Freuden und Leiden dieses fragilen Minne-Verhältnisses auszudrücken versucht. Es ist der Mann, der unter Ausschaltung des Realistisch-Sensuellen der konkreten Wirklichkeit sich allein in seiner imaginatio fiktive Situationen, Orte, Personen - gemäß der Tradition idealisiert - vergegenwärtigt, die das Spannungsverhältnis Minne bevölkern. (5) Es ist der Mann, der jeweils neue Hilfen zur Erklärung des nicht definierbaren Minne-Begriffs in jeweils anderen Annäherungen vorträgt. Da aber Minnelyrik als Kulturphänomen Gesellschaftslyrik ist, dies auch in dem Sinn, dass sie sich nicht in individualisierten Sprachformen ausspricht, sondern standardisierten Formen, Bildern, Metaphern und Topoi gehorcht, die also die je eigentümliche Aussage des individuellen Autors in gesellschaftlich sanktionierte Sprachformeln gießen lässt, werden die in Liebeslyrik gewohnten Affekte extrem gebremst. Trotzdem ist Minnelyrik keineswegs ohne gefühlsgeladene Momente, durch die Affektreduzierung hindurch brechen sich v.a. in den metrisch-musikalischen Gestaltungen andere Ausdrucksformen der Gefühlsexpression Bahn. Zudem bedeutet gerade die Verwendung von gesellschaftlich sanktionierten sprachlichen Versatzstücken, von Topoi und ähnlichem, eine Affekterweiterung im Rezipienten. Triebsublimierung auf Produzentenseite bedeutet mithin nicht, dass die Texte ohne alle Trieb-ansprechenden Impulse auf den Rezipienten wirken. Der positiven Möglichkeiten expressiver Verstärkung im jeweiligen gesanglichen Vollzug im höfischen Rahmen der sinnenfrohen Stauferzeit werden wir uns kaum noch bewusst, da wir einerseits recht wenig über die Aufführungsbedingungen der Minnelyrik im 12. und 13.Jh. wissen, und da uns andererseits die Lieder zur papiernen Leselyrik der Gelehrtenstube geworden sind. Eine der Verstärkungsmöglichkeiten in der Vortragssituation stellt der mimisch-gestische Bereich dar, der sicher bei dialogischen Texten, beim Wechsel oder in Frauenmonologen (6) seine Wirkung nicht verfehlte, wenn der vortragende Mann die klagende, belehrende, zurückweisende etc. Frau seinen Zuhörern zu vergegenwärtigen versuchte. Die Mimik und Gestik wird wohl auch beim Erörtern der Schönheit einer Frau seine Wirkung kaum verfehlt haben, insbesondere wenn die Schönheit nicht pauschal festgestellt oder durch "die Schilderung der Wirkung, die sie ausübt" oder "den Vergleich" dargestellt, (7) sondern an herausgestellten Körperteilen festgemacht wird. Es mag als Banalität bezeichnet werden, wenn ich unterstreiche, dass der schöne Frauenkörper - und dem Liebenden ist der Körper der Geliebten stets schön - wichtigster Stimulus des Lyrikers ist, der über Liebe handelt; so wie der schöne Körper das als solches thematisierte wichtigste sexuelle Reizmittel darstellt. (8) Trotzdem muss dies hier mit Blick auf die Schönheitsbeschreibungen der Minnelyrik festgehalten werden, denn nicht die dargestellte subjektiv-einmalige Schönheit eines Individuums begegnet uns in der Minnelyrik, sondern trotz der sicherlich subjektiv empfundenen Reizwirkung wird gerade in diesem Bereich die oben angesprochene Triebsublimierung und die damit einhergehende Affektreduzierung voll wirksam. Die körperliche Frauenschönheit, der stets explizit oder implizit der hohe ethische Wert der Frau korrespondiert, gehorcht einem Topos, der auf den ersten Blick ganz aus der antiken Tradition übernommen scheint. Diesen Topos in der Minnelyrik des 12. und 13.Jahrhunderts aufzuspüren und seine der thematischen und formalen Ausweitung der Minnelyrik parallel verlaufende Entfaltung nachzuzeichnen, soll im folgenden unser Bemühen gelten. Zunächst muss die Personenbeschreibung, die personarum descriptio in der Rhetorik-Tradition von der Antike bis in das 13.Jahrhundert, die Blütezeit mal. Rhetorik, skizziert werden. Daran schließt sich breiter die Erörterung einer weiteren Herkunftsmöglichkeit aus dem Hohen Lied und daran sehr knapp die Begründung des Topos puella bella an, um schließlich die Entwicklung in der Minnelyrik anhand des hier gesammelten Textmaterials aufzuarbeiten.
Anmerkungen
|
© Dr. Rüdiger Krüger, Rheda-Wiedenbrück
2006 |