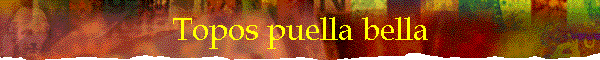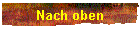
| |
TOPOS
'PUELLA BELLA'
4. DER TOPOS 'PUELLA BELLA'
Die ausführlichste Körperbeschreibung einer schönen, jungen Frau, die uns
bei der Aufarbeitung möglicher Traditionen der personarum descriptio a
corpore begegnete, ist die im HL. Sehen wir diese in drei Stufen verlaufende
sowie die an Galfred von Vinsauf exemplifizierte der mal. Rhetorik als
maßgebliche Muster für die Analyse der Körperbeschreibungen in der mhd.
Lyrik, so lassen sich vier eng miteinander verzahnte, ineinander übergehende
Beschreibungstypen festmachen.
Die vollständigste ist hierbei eine Beschreibung von Kopf bis Fuß; in den
uns hier interessierenden Fällen verläuft diese zunächst vom Kopf bis zum
Oberkörper, der sich nach einer revocatio eine exakte Beschreibung von
den Füßen bis zum Kopf, ohne Verschweigen des Unterleibs und der Scham
anschließt, die auch metaphorisch umschrieben werden kann. Wichtig ist hierbei
die fiktive Situationseinbettung in den Tanz, die für die Blickrichtung
bestimmend ist, wobei ohne Tanzeinbettung die Beschreibung auch direkt nach
unten weiter verlaufen kann, dann jedoch viel von ihrem Reiz und ihrer Dynamik
verliert. Der vollständige erste Typ begegnet uns in HL 4,1-5/(6,4-7)/7,2-6,
wobei zur Einzelbeschreibung v.a. einleitend und beschließend der ganze Körper
benannt: HL 4,1/6,4/7,7, oder einzelne Körperteile bzw. -regionen nochmals
aufgegriffen werden können: HL 6,5-7.
Der nächstkleinere Typ ist ein Beschreiben von Kopf bis Fuß unter
schamvollem Verschweigen des Schambereichs, wobei die descriptio auch
schon mit dem Oberkörper beendet werden kann. Dieser Typ tritt uns bei Galfred
von Vinsauf, Matthäus von Vendôme und anderen mal. Rhetorikern entgegen,
entspricht jedoch auch in seiner den gesamten Unterkörper aussparenden Form der
ersten Frauenbeschreibung in HL 4,1ff, die wohl aus den gleichen Gründen hier
(noch) abbricht, die auch Galfred zum Verstummen bringen.
Der dritte Typ der Körperbeschreibung zeigt nur noch eine mehr oder weniger
vollständige Beschreibung des Kopfes, wobei je nach Kulturkreis die Augen oder
der Mund am häufigsten, auch alleine, genannt werden. Sowohl als erotische
Stimuli wie auch als Kontaktpunkt (des Blickkontakts) sind diese, als Ausdruck
der Seele, der momentanen Stimmungslage ist die gesamte Gesichts-Physiognomie
wichtig. Diesen Typ finden wir in HL 6,4-7, eingeleitet durch eine allgemeine
Schönheitsansprache. Was im HL sowohl vergegenwärtigendes (verkürztes) Zitat
der schon in HL 4,1ff gegebenen Beschreibung wie auch retardierendes Verweilen
vor der folgenden, vollständigen Fuß-Kopf-Beschreibung in HL 7,2ff darstellt,
wird auch bei alleinigem Auftreten in ähnlicher, verweisender Funktion zu
verstehen sein. Der Kopf oder auch nur die Augen bzw. der Mund stehen im
emphatischen Schönheitspreis stets als pars pro toto, wie umgekehrt der
summarische Hinweis auf den schönen Körper auch für die Einzelglieder Geltung
beanspruchen darf. Dieses quantitive, synekdochale Verhältnis ist ja für viele
Topoi, in welchen aus nur wenigen Andeutungen ein ganzes Bild, eine Stimmung
oder ein Gefühl evoziert werden soll, maßgeblich.
Die drei vorgestellten Typen der Körperbeschreibung, die weitgehend von den
Beschreibungen von Männern abweichen, richten sich in der mal. Literatur, v.a.
Lyrik, potentiell stets auf junge Frauen bzw. (geschlechtsreife) Mädchen, die
sich durch ein eindeutiges Schönheitsideal auszeichnen, das man knapp als
schlank, wohlproportioniert, zartgliedrig, mit kleinen Brüsten, langen
Armen/Händen/Fingern, blonden Haaren, rotem Mund und einem sanften Lächeln
ausgestattet umschreiben kann - ich möchte dies als gotisches Frauenideal
bezeichnen.
Ob die einzelnen Frauenbeschreibungen der mhd. Lyrik nun aus entsprechenden
Anweisungen und Mustern der mal. Rhetoriken stammen - wie meist behauptet - oder
ob das Beispiel des HL oder evtl. vorgefundene Anregungen aus der mlat. oder
provenzalischen Liebeslyrik mustergültig gewirkt haben, ist im einzelnen, wie
auch die gegenseitigen Einflüsse der genannten Bereiche aufeinander, nicht mehr
exakt nachvollziehbar. Inwieweit die gängigen Muster der Beschreibung von Kopf
bis Fuß und das umgekehrte Tanzmuster nicht einfach einer anthropologischen
Konstante der Blickführung von der Augen-/Kopfhöhe dem anatomischen Prinzip
folgend nach unten oder vom die Aufmerksamkeit fokussierenden Tanzschritt dem
gleichen Prinzip folgend nach oben gehorcht, wobei die sexuell-erotisch
konnotierten Körperteile je nach positiver oder negativer gesellschaftlicher
Sanktionierung verschwiegen oder eventuelle negative Sanktionen durchbrechend
genannt werden, soll hier nicht weiter diskutiert werden.
Die vorgestellten Typen der Körperbeschreibung der jungen, schönen Frau,
die sich als infinite Formen in der folgenden untergliederten Systematik zeigen,
sollen in ihrer Gesamtstruktur als Topos puella bella bezeichnet werden.
EXKURS: Zur Bezeichnung des Topos.
Nicht nur einer Laune folgend endstand diese klanglich
reizvolle Verbindung puella bella. Die Bezeichnung personarum
descriptio a corpore als übergeordnetes Muster verweist zum einen zu
direkt auf ihre Herkunft aus schulrhetorischer Tradition; zum anderen ist
selbst in dieser Tradition die durch die Liebe angeregte Frauenbeschreibung
auf die junge Frau, das geschlechtsreife Mädchen bezogen und nimmt eine
Sonderstellung ein: "si agatur de amoris efficacia [...], praelibanda est
puellae descriptio et assignanda puellaris pulchritudinis elegantia
[...]." Da das lat. pulcher zu viele Nebenbedeutungen hat,
abgenutzt ist und zudem relativ hart klingt, und da amoenus - obwohl
die semasiologische Nähe zu amo für die Liebeslyrik passend wäre -
schon dem Topos locus amoenus, der oft mit puella bella in
Verbindung auftritt, zugeordnet ist, habe ich mich für das seltene und späte
bellus mit den treffenden Bedeutungen 'hübsch, fein, nett, niedlich,
artig, köstlich' entschieden. Für bellus sprechen zudem die
etymologische Herkunft von *benlus, Diminutiv zu *benus=bonus
und daher die Verbindung zum für unseren Zusammenhang wichtigen
ethisch-moralischen Bereich, sowie die reizvolle Klangform - weich, klangvoll
und rund das puella, mit stimmhaftem Einsatz, beinahe identisch
wiederholend: puella bella.
Struktur des Topos puella bella:
 | I.a Vollständige Gesamtkörperbeschreibung
 |
von Kopf bis Fuß; |
|
 |
b mit situationsabhängiger Umkehrung
 |
von Fuß bis Kopf.
|
|
 |
II.a Gesamtkörperbeschreibung unter Aussparung des
sexuell konnotierten Unterleibs (evtl. der Brüste)
 |
von Kopf bis Fuß;
|
|
 |
b nur Oberkörperbeschreibung (mit oder ohne Brüste)
 |
von Kopf bis Hand.
|
|
 |
III.a Gesamtkopfbeschreibung
 |
vom Haar bis zum Kinn/Hals;
|
|
 |
b Beschränkung auf wenige Teile oder gar nur eine Teil
 |
-meist Augen oder Mund. |
|
Die finite Verwirklichung dieses Topos in der mhd. Minnelyrik, seine
zögernden Anfänge, mutigen Erweiterungen bis hin zur Ausbreitung des
vollständigen Typs sollen im folgenden vor der Folie der personarum
descriptio a corpore der mal. Schulrhetorik und den Beschreibungsliedern des
HL-'Frühlingszyklus' kurz angerissen werden, wobei wir zunächst einige
grundlegende Überlegungen anhand exemplarischer mhd. Textausschnitte zur
Diskussion stellen wollen. Bei den folgenden Analysen sowie der entdeckenden
Eigenlektüre der mhd. Lieder muss ein besonderes Augenmerk dem je individuellen
Umgang mit den Strängen der Tradition des Topos puella bella, d.h. der
jeweiligen dichterischen Eigenleistung gelten, die den ästhetischen Reiz des
Einzelliedes, der einzelnen Einbettung der Beschreibung der schönen Frau,
ausmacht.
Anmerkungen
[Die folgenden Anmerkungen werden in Kürze dem Text
zugeordnet!]
Ich differenziere diese Typen anders als Baehr
(1956) S.126-128, dessen erste beiden Typen (1. allgemeines, hyperbolisches Lob,
ohne Einzelheiten; 2. summarischer Gesamteindruck) eigentlich keine Typen der personarum
descriptio a corpore darstellen, und von dessen weiteren zwei Typen (3.
einer oder mehrere Teile des Kopfes; 4. Beschreibung im einzelnen) v.a. der
letzte noch weiter unterteilt werden muss. Leube-Fey (1971) S.39-48 bringt die
gleiche Einteilung nach Baehr.
Siehe zum funktionalen Einsatz der
Ganzkörpernennung die Hinweise auf mal. Rhetoriken und Körperbeschreibungen
in: Leube-Fey (1971) S.24. Zum synekdochalen Gebrauch a toto ad partes
und a partibus ad totum zur Steigerung der Affekte vgl.: Lausberg (1973)
§ 257,3c.
Vgl. 'Poetria nova' V.568-602.
Vgl. die Beschreibung der schönen Helena in: 'Ars.vers.'
I,56: .i.Kopf ;und .i.Oberkörper ;ausführlich; 'Ars.vers.' I,57: kurze
Gesamtkörperbeschreibung.
Vgl. die von Baehr (1956) S.127f zitierten Verse
aus einem Salutz (Liebesbrief) des Provenzalen Arnaut de Maruelh; S.128:
Maruelh "beschreibt [...] der Reihe nach die Haare, die Stirne, die Augen,
die Nase, das Gesicht, den Teint, den Mund, die Zähne, das Kinn, den Hals, die
Brust, die Hände und die Finger. Die Abfolge von oben nach unten ist
sorgfältig beobachtet [ob Baehr hier nicht 'beachtet' meint?]. Wenn die
Beschreibung bei den Fingern aufhört, so ist dies vielleicht im vorliegenden
Falle eine Frage der Schicklichkeit, da es sich um eine Dame handelt."
Warum aus "der vollständigen und strengen descriptio" Ohren,
Arme und Augenbrauen nicht erwähnt werden, mag im Gegensatz zu Baehrs
Spekulationen schlicht an einer HL-Rezeption im Salutz liegen, Ohren und
Augenbrauen spielen darin keine, die Arme nur in der Männerbeschreibung HL 5,14
(Hände bzw. Arme) eine Rolle. Vgl. auch: Leube-Fey (1971) S.45.
Vgl. das zu den Tropen Gesagte in: Lausberg
(1973) v.a. §§ 558-598.
Vgl. Brinkmann (1925) S.93: "Das
Schönheitsideal der Gelehrten und Vaganten ist auch im Minnesang und in der
gotischen Plastik herrschend. Wir brauchen nur [...] an das gemessene Auftreten
der von Minnesingern verherrlichten Damen, an das Lächeln, die schlanke Taille,
die langen Arme der gotischen Skulpturen zu denken." Siehe auch: Brinkmann
(1928) v.a. S.164-172; Köhn (1930) v.a. S.92-105.
Vgl. auch die Straßburger Darstellungen der
Synagoge und Ecclesia, oben Abb.S.110.
Matthäus von Vendôme 'Ars.vers.' I,40.
|