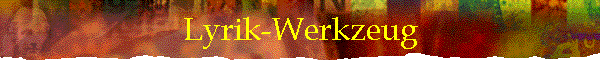Anmerkungen zum Werkzeug des Lyrikers
"Und das Gesetz erst kann uns Freiheit geben."
Vortrag von Rüdiger Krüger
gehalten am 19. Oktober 1991
beim Lyrischen Oktober 1991 * Bayreuth
Ganz herzlich darf ich mich bei den Veranstaltern und vor allem bei Herrn
Theo Cernik für die Einladung zum diesjährigen Lyrischen Oktober im herrlichen
Bayreuth bedanken, und genauso herzlich möchte ich sie – Lyrikerinnen und
Lyriker aus dem deutschsprachigen Raum - begrüßen.
Doch damit auch schon genug der rhetorisch geforderten Vorrede, genug mit dem
Ansatz einer captatio benevolentiae, die den Versuch machen soll, sie als Hörer
meines Vortrags mir geneigt zu machen. Sofort medias in res - denn nichts liegt
mir daran, sie geneigt zu machen, sich umgarnen zu lassen mit den Fäden meiner
Gedanken. Nicht schönrednerisches Einlullen wird mein Part sein, sondern
vielmehr Wachrütteln. Und sollten sie sich durch manche spitze, polemische
Bemerkung zum Widerspruch herausgefordert fühlen, so bitte ich in der
nachfolgenden Diskussion nachdrücklich um Artikulation. Nur im Gespräch
können eventuelle Missverständnisse aufgelöst und geklärt werden, und nur im
offenen Gespräch, in der Entrüstung (wenn kein herabgelassenes Visier oder ein
Panzerhemd gesichtslos einengt) können eventuelle Fronten abgebaut bzw.
korrigiert werden. Da es sich im folgenden um essayistische Reflexionen zum
Prozess des Erschaffens von Lyrik handelt, und dem Lyrischen das assoziative
Prinzip des stets mehr Meinens als Aussprechens, des - so möchte ich
versuchsweise definieren - offenen Gedankengewebes eignet, lassen sie sich auf
meinen dem angepassten assoziativen und offenen Gedankengang ein. Natürlich
wäre es wünschenswert, wenn sie mir nach Abschluss meiner Anmerkungen zum
Werkzeug des Lyrikers tatsächlich geneigt wären.
Ein zweites, das in akademischen Vorträgen stets gefordert ist, versage ich
mir: ich werde sie nicht mit Zitaten der oder Verweisen auf die Riesen der
Tradition, auf deren Schultern ich mich sitzen weiß, belasten. Zudem werden sie
merken, dass ich nicht unbedingt mit jedem selbsternannten Riesen - sei's
Kritiker, sei's Wissenschaftler - konform gehe. Auch hier erspare ich mir den
Hinweis auf meinen imaginären Gegenüber. So werden sie nur dreierlei hören
und zwar gänzlich ungeschützt: mich selbst, programmatisch die poetischen
Riesen Goethe und Hölderlin, sowie die wenigen, vor allem am Schluss meiner
Ausführungen von mir zu zitierenden Beispiele lyrischer Produktion unsres
Jahrhunderts - wobei ich hierbei gerade unbekanntere Autoren wählen werde.
Worum wird es im folgenden gehen? Um nichts weiteres als das Sprach-Material
des Lyrikers und die Werkzeuge, um aus diesem vorgegebenen, vorgefundenen
Material Lyrik zu schaffen. Denn so wie der Plastiker, der Bildhauer den je
unterschiedlichen Materialien mit verschiedenen Werkzeugen und Verfahrensweisen
zu Leibe rückt, um eine Granit-, Marmor-, Alabaster- oder Bronceplastik zu
erschaffen, so wird auch in der Lyrik mit unterschiedlichem Werkzeug und
unterschiedlichen Arbeitsweisen und -gängen das Material be- und verarbeitet.
Und so wie in der modernen Bildhauerei eine Emanzipation des Gebrauchsmaterials
und seiner ästhetischen Umschöpfung Einzug gehalten hat, so ist auch im
Bereich der Poesie dem Alltäglichen die Türe geöffnet worden.
Doch zur Klärung des Werkzeugs und des Sprach-Materials muss zunächst eine
Klärung des zu erstellenden Werkstücks vorgenommen werden. Ein Schreiner
bearbeitet Holz. Welches Holz er verwendet und welche Werkzeuge er zu dessen
Behandlung einsetzt, wird vor allem davon abhängen, welches Produkt er erzeugen
möchte. Ein Bauschreiner und ein Möbelschreiner werden sich hierin aufs
äußerste unterscheiden. Und wenn der Möbelschreiner zudem kunsthandwerklich
anspruchsvolle Designmöbel sowohl selbst entwirft als auch selbst anfertigt, so
gelten nochmals ganz andere Bedingungen für die Material- und Werkzeugauswahl,
die er treffen wird.
Dieser letztgenannte Handwerker-Künstler, den es in unserer spezialisierten
Welt nur noch sehr selten gibt, wird eine mehrjährige Schreinerausbildung
durchlaufen, um über Materialbeschaffenheit und die zur Bearbeitung möglichen
Werkzeuge und Verfahrensweisen Kenntnis zu erlangen und die Handgriffe
einzuüben. Er wird sich des weiteren die verschiedenen Design-Theorien unserer
Zeit sowie die Geschichte des Möbeldesigns aneignen, um darin seinen
unverwechselbaren Stil zu finden. Und er wird es dann bei der Vermarktung seines
Produktes nochmals mit Schwierigkeiten zu tun bekommen, wenn er dem
Zeit-Geschmack nicht Tribut zollt. Dass seine Möbel ihrem Zweck des
Darauf-Sitzens, des Etwas-Darin-Verstauens etc. Genüge leisten müssen, sollte
sich von selbst verstehen.
Und wer die genannten Ausbildungsschritte nicht in irgend einer Form
absolviert hat, und sei es, dass er sich die Inhalte als Autodidakt angeeignet
hat, wird sich schwer tun, in der Möbeldesign-Welt zu bestehen. Der
Nicht-Ausgebildete wird bestenfalls als Hilfsarbeiter oder Angelernter in einem
größeren Betrieb Arbeit finden.
Man mag mir entgegenhalten, das knapp Umrissene gelte für (Kunst-) Handwerk,
aber keinesfalls für die Erstellung von Kunstwerken. Dies stimmt mit Sicherheit
nicht. Ein kurzer Blick auf den Plastiker, der sich mit dem Werkstoff Holz
auseinandersetzt, scheint mir hier nützlich. Auch für ihn gilt, was ich zum
Möbelschreiner mit Design-Ambitionen gesagt habe. Wenn auch nicht jeder
Holz-Plastiker eine Schreiner-Lehre absolviert hat, so kann er doch nur
bestehen, wenn er sich eine gründliche Kenntnis der Holzarten, ihrer
Materialeigenschaften sowie der zum Bearbeiten notwendigen Werkzeuge angeeignet,
und wenn er zudem die Holzbearbeitung erlernt und eingeübt hat. Eine profunde
Kenntnis der Geschichte der Plastik und ihrer im 20. Jahrhundert hinzugewonnen
Möglichkeiten wird ihr übriges tun, um die Erstellung einer Holzplastik zu
befördern. Was natürlich dann folgt, ist nicht mehr erlernbar und kann hier im
Blick auf den Lyriker hernach auch nur kurz gestreift werden.
Sie werden sich fragen, wann denn nun eigentlich der Blick auf den Lyriker
kommt, und was das bisher Gesagte mit dem gestellten Thema zu tun hat. Nun, wir
sind schon mitten im Thema, wenn auch die Analogie nicht sofort ins Auge
springt, weil eben das Material des Lyrikers nicht stofflicher sondern geistiger
Natur ist. Sprache und Holz
scheinen auf den ersten Blick nichts miteinander gemein zu haben. Und auch
der Prozess der Schaffung eines Holz- und eines Sprachkunstwerks ist umgekehrt.
Aber sie sind umgekehrt proportional. Wo der Holzplastiker bemüht sein muss,
nicht zuviel von seinem Holzrohling zu entfernen und vor allem die richtigen
Späne an den gewünschten Stellen abzulösen, um die künstlerisch gewollte
Figur zu erreichen, so muss der Sprachkünstler stets darauf achten, kein zuviel
an Worten und diese in der richtigen Reihenfolge zu setzen, um nicht der
beliebigen Geschwätzigkeit anheimzufallen oder hölzern zu wirken. Doch dazu
später mehr.
Was ein Möbelstück ist, wissen wir. Was man sich gemeinhin unter einer
Plastik vorzustellen hat, ist schon weniger klar umrissen. Doch ich denke, dass
in den meisten Fällen die Abgrenzung zwischen Möbelstück und Plastik gelingen
wird. Doch was ist ein Gedicht? Erwarten sie von mir keine Antwort - sie ist
letzthin nicht möglich. Gesagt werden kann nur, was in den jeweiligen Epochen
und den jeweiligen Kultur- und Sprachkreisen für ein Gedicht gehalten wurde.
Und doch ist eine Annäherung möglich, denn nicht ein jeder Text kann von sich
in Anspruch nehmen, Gedicht zu sein. Oder besser gesagt: wir dürfen getrost
unterscheiden zwischen einem Text, den sein Verfasser als Gedicht bezeichnet,
und einem Sprachkunstwerk, das von jedem Kenner als Lyrik aufgenommen wird. Doch
auch zum Wesen dessen, was als Gedicht bezeichnet werden kann, später in
Ansätzen mehr.
Eindringlich sei hier auf ein ökologisches Problem bei der Produktion von
Lyrik hingewiesen. Bei ständig knapper werdenden natürlichen Ressourcen sollte
sich jeder fragen, ob er auf das Blatt Papier, das vor ihm liegt, tatsächlich
nur so wenige Worte schreiben möchte; ob es nicht Verschwendung ist, soviel
freien Raum um seinen Text anzuhäufen. Erst wenn er sich selbst und anderen
gegenüber begründen kann, warum dieser Text in der vorliegenden Form des
Zeilenumbruchs an Stellen bedarf, wo noch Raum genug wäre, weiterzuschreiben,
erst wenn die Begründung schlüssig ist, warum dieses Textgebilde nur so wenige
Zeilen hat, obwohl doch oben und unten noch viel Weißes nach Beschreibung
verlangt, mag er sich seufzend damit abfinden, als Lyriker mit Papier
verschwenderischer als andere umgehen zu müssen. Sonst sollte er es bei der
ökologisch sinnvolleren, weil Papier besser verwertenden Prosa belassen - oder
lieber gar nichts schreiben außer Einkaufs- und anderen Merkzetteln. Nicht
alles was als Lyrik bezeichnet wird, darf als solche ernst genommen werden; auch
wenn eine ästhetische Richtung des 20. Jahrhunderts uns glauben machen will,
dass das einzelne Individuum berechtigt sei, ein Werk zum Kunstwerk zu
erklären. Und in der gerade in den letzten Jahren massenhaft auftretenden Lyrik
ist dies in besonderem Maße der Fall. Gedicht ist anscheinend, was der
Schreiber eines Textes als solches bezeichnet. In den anderen Kunstformen Musik
und Malerei ist dies Übel bei weitem nicht so ausgeprägt, obwohl im Bereich
der Hobby-Malerei noch immer röhrende Hirsche und flatternde Wolkenengelchen
Anregungen zu eigenem Künstlerschaffen zu geben scheinen. V.a. in der Musik
wird es jedem sofort eingehen, dass man zunächst die Sprache der Musik auf das
genaueste lernen und beherrschen muss, bevor man sich überhaupt anheischig
machen darf, ein Musikstück öffentlich vorzutragen. Und erst ein gründliches
Studium des Tonsatzes unter Einschluss der Geschichte der Kunst der Komposition
wird einen in den Stand setzen, eine Musikkomposition zu erschaffen. Ob es sich
dann um ein originäres Kunstwerk handelt, steht zunächst nicht zur Debatte.
Wer schriftstellerisch tätig werden möchte, wird zunächst kaum auf den
Gedanken kommen, sich im Drama oder dem Epos zu erproben. Zumeist wird hier die
Lyrik vorgezogen. Denn wer Reden kann, kann auch Lyrik schreiben, oder anders
formuliert: "beim Fensterputzen fällt mir wegen dem Hoch und Runter auf
der Scheibe immer besonders gut was ein!" So drückte es einmal eine dieser
Pseudo-Lyrikerinnen aus, als sie gefragt wurde, wie sie denn auf diese schönen
Worte zu Problemen komme, welche die Fragestellerin auch schon einmal so
unendlich tief empfunden habe. Ich kann dies nur mit dem etwas überdehnten
Titel eines Frauenmagazins kommentieren, in welcher solch pseudo-lyrische
Elaborate manchesmal abgedruckt erscheinen:
Brrrr...iigitt...äääää!!!!!
Warum fühlen sich so viele berufen zum Schreiben, und warum muss es dann
gerade Lyrik sein? Natürlich ist es einfacher, wenige Zeilen zu schreiben als
mehrere Seiten, und genauso natürlich wird ein Blatt Papier schneller voll,
wenn ich es nicht ganz voll schreibe und doch für voll erkläre. Aber darf man
so etwas wirklich per se als Lyrik ernst nehmen. Dass wir uns richtig verstehen,
Schreiben kann Therapie sein. Schreiben - und gerade auch der Versuch, dem
Geschriebenen eine feste Form zu geben, einen Gedanken möglichst verdichtet
auszudrücken - kann zur Problembewältigung beitragen, kann uns bei der
Selbstfindung helfen. Auch die wenigen formal gebundenen Zeilen an einen
geliebten Menschen, Trostworte und ähnliches mögen ihren wichtigen Sinn haben.
Dass gerade die schwierigste der poetischen Ausdrucksmöglichkeiten gewählt
wird, um Allgemein-Menschliches, Gefühliges zu entbergen, um sich als Subjekt
sich selbst oder einem vertrauten Du zu offenbaren, hat wohl nicht zuletzt mit
dem mythischen Urgrund des lyrischen Sprechens zu tun - doch dürfte gerade dies
den solcherart Schreibenden ein zutiefst unbewusstes Phänomen sein. Aber ist
das, was so entsteht, dieses Private - ja teilweise Intime, Lyrik, muss das als
solche veröffentlicht werden - in Gedichtbänden oder Lesungen?
Hier ist nicht die Zeit, tiefer in dieses Problem einzusteigen, wiewohl ich
hernach noch einige Texte dieser Art, die zum Teil recht erfolgreich den
Buchmarkt erobert haben, zitieren werde.
Den Titel meines Vortrags, dessen Untertitel ich bisher - mich vorsichtig
nähernd - abgeschritten habe, umfasst die Schlusszeile eines Sonetts von
Goethe: 'Und das Gesetz erst kann uns Freiheit geben'. Dieses Sonett, das sich
mit der Auseinandersetzung zwischen Natur und Kunst beschäftigt, stellt die
Abgrenzung aller Kunst von der Natur dar. Es bringt auf den Nenner die in jedem
ästhetisch denkenden und fühlenden Menschen vorhandene Antinomie, und es
versöhnt die sich grundsätzlich gegenüberstehenden Sphären des vom Menschen
als Kunst Geschaffenen und der den Menschen als unabhängig von ihm
gegenüberstehenden - doch auch geschaffenen - Natur, von der er ein Teil war,
an der er Teil hat, und von der er wieder Teil wird. Dieses Sonett Goethes
vergleicht die Verschränkung von Natur und Kunst im sich um Kunst bemühenden
und daher sich von der Natur entfernenden Subjekt gerade im Moment des tiefsten
Sich-Einlassens auf Kunst mit dem Bildungsbegriff. Und es postuliert die
Unmöglichkeit des Strebens eines sich keiner Bindung unterwerfenden Künstlers,
ohne Einlassen auf die Zwänge und Regeln der überkommenen Bildung Höhe und
Vollendung zu gewinnen. Doch lassen wir nun zunächst Goethe zu Wort kommen:
Natur und Kunst
Natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen.
Und haben sich, eh man es denkt, gefunden;
Der Widerwille ist auch mir verschwunden,
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.
Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen!
Und wenn wir erst in abgemeßnen Stunden
Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden,
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.
So ist's mit aller Bildung auch beschaffen:
Vergebens werden ungebundne Geister
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.
Wer Großes will, muß sich zusammenraffen;
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz erst kann uns Freiheit geben.
Erst das sich Beugen unter das von der Bildung an die Hand gegebene Gesetz
kann dem Schöpfer ästhetischer Objekte die Freiheit verschaffen, Meisterschaft
zu erreichen. Noch strikter, noch stärker die notwendige Traditionsgebundenheit
des Künstlers - und dies ist bei Goethe zumeist der Dichter - ja das
Traditionsbewusstsein unterstreichend drückt er dies in einer der Zahmen Xenien
aus:
"Ich hielt mich von Meistern stets entfernt;
Nachtreten wäre mir Schmach!
Hab alles von mir selbst gelernt."
-Es ist auch darnach!
Erst die Kenntnis des Gesetzes, erst das Ausloten der Bedingungen der
Möglichkeiten, ein lyrisches Sprachkunstwerk zu schaffen, kann uns die Freiheit
des schöpferischen Aktes geben. Dem ästhetischen Kreationsprozess kann nie
Zwang zugrunde liegen; Verkrampfung wäre die Folge und das Resultat: verholzter
Krampf.
Der einsam in der sibirischen Tundra umherstreifende Wolf hat keinen Begriff
der Freiheit. Er lebt in der Daseinsform des Herumstreifens, ohne dessen
Qualität festmachen zu können. Nur die Kenntnis anderer Daseinsformen, erst
das Wissen um die Tatsache, dass die Wirklichkeit nur eine Auswahl aus der sie
übersteigenden Zahl an Möglichkeiten darstellt, vermittelt eine Ahnung der
Qualität seines derzeitigen Zustandes. Erst wenn der Wolf das Gegenteil seiner
natürlichen Daseinsform, das Eingesperrtsein, das Leben hinter Gittern kennen
gelernt hat, dämmert ihm eine Ahnung der Qualität von Freiheit, Weite,
Ungebundensein.
Doch aus welchem Käfig muss der Dichter sich befreit haben, was ist das
Gesetz, dem das lyrische Gebilde unterliegt, und das der Lyriker in sich
aufgesogen haben muss, wie der Säugling die Muttermilch, um eben dieses
lyrische Gebilde erschaffen zu können. Können wir überhaupt angeben, welchen
unabdingbaren Bedingungen ein Text unterworfen ist, um als Gedicht bezeichnet,
um als Lyrik ernstgenommen zu werden? Ja, wir können es - wir müssen dies
sogar, um im Sumpf der sich als Lyrik bezeichnenden Textchen nicht stets tiefer
in den Morast zu geraten, sondern Wegweisung zu bekommen zu festerem Gelände,
um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Gerade demjenigen, der sich
zum Schreiben aufmacht, der meint, genügend ästhetische und sprachliche Potenz
und Kompetenz zu besitzen, um Gedichte zu schreiben, seien die folgenden
Anmerkungen ins Stammbuch geschrieben.
Sprache ist ein Zwitterwesen. Auf der einen Seite ist sie Bedeutungsträger,
bietet Manifestation von gedanklichen Inhalten, auch Empfindungen
einschließend; auf der anderen Seite ist sie Klanggestalt und zeichnet sich je
nach Kulturkreis durch unterschiedliche Tonhöhen und -dauer sowie
unterschiedliche Arten von Akzentverhältnissen aus. Dieser zweite Aspekt von
Sprache als Schallform ist in unserer verschriftlichten Kultur neben dem Theater
und wenigen Lesungen nur mehr mit Blick auf musikalische Umsetzungen von Sprache
als Lied, Chanson, Song oder in Oper und Konzertsaal gegenwärtig; obwohl sich
durch die Umwandlung unserer vormaligen Industriegesellschaft in eine
Informationsgesellschaft mit ihrem Einsatz vielfältiger verbaler und
nonverbaler Kommunikationsmittel hier das Gewicht wieder zu verschieben droht.
Hierzu - auch im Blick auf die Zunahme des Analphabetismus und von
Sprachstörungen, wären einige zivilisationskritische Anmerkungen zu machen,
die ich mir aus Zeitgründen versage, obwohl mir ein Nachdenken hierüber gerade
für den Lyriker höchst bedenkenswert erscheint. Natürlich ist Sprache in
einer verschriftlichten Gesellschaft, wie sie der deutsche Kulturkreis seit
nunmehr knapp 1.300 Jahren darstellt, auch ein optisches Phänomen. Dies
natürlich mehr und mehr, nachdem sich die Schriftlichkeit auch durch die
Entwicklung des Buchdrucks vor 500 Jahren stärker und stärker durchsetzte.
Gerade Renaissance und Barock brachten mit emblematischen Lyrikformen einen
Anstoß, der letzthin zu den graphischen Sprachgebilden des DaDa und der
konkreten Poesie unseres Jahrhunderts führte. Und neben die ästhetischen
Qualitäten, die das akustische System Sprache bereithält, treten seither stets
mehr oder weniger stark die ästhetischen Qualitäten, die konkurrierende
Schreibsysteme bergen. Im Entbergen, im Aufdecken der audiovisuellen
Möglichkeiten, die Sprache je in sich trägt, liegt neben inhaltlichen und
strukturalen Faktoren die ästhetische Valenz eines jeden Sprachkunstwerks.
Nicht umsonst nimmt die optische Gestaltung von Schriftstücken, die Auswahl, ja
teilweise Neugestaltung von Schrifttypen und das Layout einen großen Raum in
der Drucklegung poetischer Werke ein. Man denke hier mit Blick auf die Lyrik vor
allem an die Zeit des Jugendstils und den George-Kreis oder auch an Rainer-Maria
Rilke und solch aufwendige Projekte wie die kleine Insel-Bücherei.
Dass die drei poetischen Schwestern Epik, Dramatik und Lyrik je eigenen
Gesetzen und Moden gehorchen und unterworfen sind, ist unbestritten. Mit dem
Aufkommen der Schriftlichkeit emanzipiert sich mehr und mehr auch die Prosa als
Kleid der Schwestern, oder versucht zumindest in deren Modewelt einzudringen. Wo
die Epik schon im 13. Jahrhundert das in einer mündlichen
Kommunikationsgesellschaft notwendige mnemotechnische Gewand der gebundenen
Sprache zu Gunsten der Prosa abzustreifen beginnt, hält sich die elegante Mode
bei den beiden Schwestern sehr viel länger. Dies hängt wohl nicht zuletzt mit
der mündlichen Seinsweise von Drama und Lyrik zusammen. Und wenn die Dramatik
schon im 19. Jahrhundert, v.a. im Realismus und Naturalismus beginnt, das Kleid
zu wechseln, so setzt die Mode der Prosa versuchsweise auch in der Lyrik im
ersten Viertel des 20. Jahrhunderts ein. Der Dramatik, die sich mehr und mehr
der poetisch gehobenen Alltagssprache bedient, passt die neue, zeitgemäße
Kleidung vorzüglich. Doch die etwas exzentrische femme fatale Lyrik sperrt sich
gegen dies ihr wenig kleidsam erscheinende Gewand, das um ihren zartgliedrigen,
ausdrucksstarken Körper schlottert wie ein Sack mit zu weiten und langen
Ärmeln, einem zu engen, ja den grazilen Hals fast einschnürenden Ausschnitt
und einer am Boden schleifenden Länge, über die unsere tänzelnde Dame stets
zu straucheln droht. Nein - dies ist nicht die Mode, die ihr auch nur annähernd
passt; es sei denn, sie würde sich die Wampe voll fressen und mit verdoppeltem
Gewicht ihrer epischen Schwester ähneln, ohne im entferntesten deren stolze,
wohlproportionierte Körperfülle zu erreichen. Lächerlich würde sie sein -
sich selbst der Lächerlichkeit preisgeben.
Was im Bild der drei ungleichen Schwestern schon in nuce aufschien, muss im
Blick auf die Lyrik, auf Gedichte genauer beleuchtet werden. Interessanterweise
sind die Begriffe der Lyrik und des Gedichts noch junge Namen. Das Gedicht
bezeichnete ursprünglich alles schriftlich Abgefasste. Hier zeigt sich die
Beeinflussung des ahd. dihton, tihton in der Bedeutung von schreiben durch das
lat. dictare. Im 18. Jahrhundert erst wurde der Begriff auf die Poetik
eingegrenzt, wobei zunächst der Gesamtbereich der poetischen, d.h. freien
schöpferischen Erfindung eines Dichters - und damit auch die Epik und Dramatik
mitgemeint waren. Allerdings setzte sich mit dem Aufkommen der Prosa in der
Dramatik der Begriff des dramatischen Gedichts fest für Bühnendichtungen in
gebundener Sprache, in Versen. Die Einschränkung des Begriffs Gedicht auf den
lyrischen Bereich, wie es sich heute allgemein durchgesetzt hat, ist jüngeren
Datums.
Die Geschichte des Begriffs Lyrik ist nochmals um einiges interessanter und
aufschlussreicher im Hinblick auf den zu erörternden Sachverhalt. Als poetische
Gattung neben den schon viel früher als solche emanzipierten Bereichen Dramatik
und Epik wird die Lyrik erst im 18. Jahrhundert als dritte Hauptgattung
klassifiziert. Und doch existiert sie in fast allen Kulturkreisen von Anbeginn
jeder greifbaren sprachlichen Tradierung. Sie ist ursprünglich in unserem
abendländischen Kulturkreis zur Lyra vorgetragener Gesang. Als solcher steht
sie an der Nahtstelle einer vorgeschichtlichen, vorkulturellen Gesellschaft zur
Artikulation des Menschen als Kultur- und Gemeinwesen, im Abendland zuerst im
griechischen Kulturkreis fassbar. Dem Mythos entwächst in Zauber- und
Segensformel, in Totenklage und Freudengesang, in Arbeits- und Kriegslied - den
sogenannten einfachen Formen - das Kultlied. Ihr in den Jahrhunderten erworbener
grandioser Formenreichtum, ihre Breite der Möglichkeiten des Ausdrucks
menschlicher Seins- und innerer wie äußerer Erlebenswelten, haben bis heute
nie die ursprüngliche Herkunft aus dem Lied, ihrer ursprüngliche Bindung an
eine musikalische Seinsweise verloren. Sie, die Lyrik, ist die Urform aller
Poesie, aller Dichtung. (Nicht umsonst heißt die Lyrik in vielen europäischen
Sprachen schlicht Poesie, Dichtkunst.) Erst als ihre beiden jüngeren Schwestern
begannen, das gemeinsame Kleid der gebundenen Sprache abzulegen, die
mnemotechnische Hilfe des rhythmisierten Verses als Speichermedium einer zu
übermittelnden Nachricht dem prosaischen Pergament und Papier und der Tinte und
Druckerschwärze zu übereignen, trat sie voll Selbstbewusstsein auf den Plan
und beharrte - allen Versuchen, ihr ein Sackleinen überzustreifen wehrend - auf
ihrem nunmehr angestammten Namen: Lyrik. Damit stets an ihre Urgründe im
orphischen Gesang erinnernd.
Trotz der oben gemachten Einschränkungen zu verschriftlichter Lyrik sind
emblematisch-optische Phänomene nichts weiter als äußerliche Accessoires, als
zusätzliche Schmuckmöglichkeiten in einer dem optischen Lese-Reiz hingegebenen
Moderne. Das eigentliche Gewand der Lyrik zeichnet sich durch knappen, klar
konturierten Schnitt aus, der dem je verwendeten Gewebe und seinem Farbmuster
angepasst ist. Einer einheitlichen, alle Phänomene einschließenden und daher
näherungsweise vollständigen Begriffsbestimmung versagt sich die Lyrik, die in
mannigfaltigen Erscheinungsweisen, je nach historischer, kultureller und
gesellschaftlicher Herkunft einhergeht. Ob dem Lyrischen stärker der
empfindsam-subjektive und unmittelbare Gefühls- und Gemüts-Gestus oder mehr
das Artifizielle und die mittelbare weltanschaulich-reflektierende Haltung des
objektiv-öffentlichen Aussprechens eignet, ist je nach historischem Kontext
unterschiedlich bewertet worden. Ein Mittelweg, mit einem je nach Text und Thema
Mehr oder Weniger der emotionalen oder intellektuellen Seite, ein stets
unterschiedliches Mischungsverhältnis beider Inhaltsweisen mag der Wahrheit am
nächsten kommen. Über eines bestand und besteht jedoch cum grano salis in
einer möglichen Definition des Wesens von Lyrik Einigkeit. Konstante Elemente
jeglicher Lyrik - ja und hier fügen sich selbst die meisten Formen von Prosa im
Gedicht ein - sind Rhythmus und Vers, sowie in etwas weniger starkem Maß
Metrum, Bild und Kürze. Dass im Bereich der Konstanten Metrum und Vers
Bindungs- und Gliederungsmöglichkeiten wie Reim und Strophe je nach
historischem Ort aber auch je nach Stärke der Betonung der liedhaft-mündlichen
Seinsweise eine mehr oder minder große Rolle spielten und spielen, sei
ergänzend hinzugefügt. Der relativ strengen, stets durchdachten äußeren Form
korrespondieren weniger starre und weniger leicht fassbare Konstanten der
inneren. Zusammenfassen lassen sich alle weiteren Konstanten der inneren Form,
die einen Text als Lyrik konstituieren, in der Forderung nach Sprachökonomie,
nach Verdichtung von Sprache und Gedanke, in der Qualität des Lakonischen.
Alles was wir in der Beschreibung des lyrischen Einzelgebildes mit Abbreviatur
und Konzentration komplexer Sinnzusammenhänge, ja Sinnverdichtung und
Bedeutungsintensität bezeichnen, was wir in der Analyse von Lyrik als Gewebe
gedichtimmanenter und -übergreifender Verweise und Bezüge, als Wiederholungen
inhaltlicher oder formaler Kennzeichen herausstellen, ist in seiner Summe reine
Verdichtung. Und wie das Verdichtungsverhältnis in einem Verbrennungsmotor für
dessen Leistung mitverantwortlich ist, so ist es auch im Gedicht für dessen
Explosivkraft und Wirkungsmächtigkeit im Sinne des inhaltlich Intendierten
maßgeblich. Als Drittes neben der äußeren und inneren Form gilt noch, was
jedem Kunstwerk - nicht nur der Lyrik - eignet, das aber gerade in der Lyrik in
besonderem Maß zu deren Wertigkeit als Kunstobjekt beiträgt: Die Architektur
des Gedichtes, seine Tektonik. Alles ist an dem Platz, wo es hingehört, um das
Ganze zu formen - die kleinste Veränderung zerstört das vorgegebene Ganze.
Hier zeigt sich in der Lyrik besonders lucide die Bedeutung von Text als Gewebe,
Verwobenes.
Ein Blick ist noch zu werfen auf das Phänomen des Verses, der bis auf die
wenigen Versuche, das Gedicht der Prosa zu öffnen, zu den festen Konstanten der
äußeren Form von Lyrik gehört. Wir können recht genau angeben, was unter
einem Vers zu verstehen ist, auch wenn manch einer in jüngerer Zeit den Vers
gewaltsam umdefiniert, oder gar in durchaus ehrgeiziger Absicht meint, Verse zu
schreiben und so ganz und gar daneben trifft. Friedrich Torberg, der
Epiker und gefällige Erzähler aber auch Lyriker hat dies einmal markant
gegeißelt:
Seit ich
In einem literaturkritischen Aufsatz
Ein Zitat von Peter Weiß gelesen habe
Welches besagt
"... daß in einem zurückgebliebenen Kolonialland
das Proletariat eher die Macht ergreift
als in den entwickelten westlichen Ländern"
Und seit ich
Demselben Aufsatz entnommen habe
Daß es sich hier um Verse handelt
Schreibe ich nur noch
Verse.
Das vom lat. versus in der Bedeutung von Wendung (des Pflugs) abgeleitete
Wort, nicht zu verwechseln mit dem im Kirchenlied gebräuchlichen Vers =
Strophe, findet in seinem auf die Gedichtzeile eingeschränkten Gebrauch
bezeichnenderweise erst seit dem 17. Jahrhundert Eingang in die
Beschreibungssprache der Lyrik. Zuvor galt das dem nhd. Reim entsprechende mhd.
rîm. Denn der alten deutschen Dichtung ist in allen drei Gattungen zunächst
der Gleichklang von Wörtern vom letzten betonten Vokal ab am Versende als
mnemotechnischer Bindestoff grundlegend. Erst mit dem Eindringen antiker,
reimloser Vers- und Strophenformen in Spätmittelalter, Renaissance und Barock
ist der Reim nicht mehr verskonstituierendes Mittel. Dies ist die Stunde des
heute übergeordneten Begriffes Vers. Die Konstanten des Verses als
einheitsstiftendes Element des Gedichts sind eine relativ exakt definierbare
Binnenstruktur rhythmischer Art sowie eine das Ende markierende Pause. Die
Endmarkierung kann durch Reim, Assonanz und Kadenz klanglich besonders
hervorgehoben werden. Alle Möglichkeiten von strengem Zeilenstil, d.h. von
Übereinstimmung der metrischen und syntaktischen Struktur, bis hin zur
Aufbrechung des Syntagmas im Enjambement ja bis hin zur beinahe völligen
Verwischung der Versgrenzen sind lyrisch gestaltet worden. Wobei historisch eine
Tendenz von strengen zu freien Formen hin festzustellen ist, obwohl neben den
Befreiungsversuchen von vorgegebenen Versschemata stets ein Strang formaler
Traditionsgebundenheit im Spiel mit überkommenen Formen weiterlebt - und gerade
in letzter Zeit neben Grenzsprengungen der totalen Auflösung des Versgefüges
wieder eine besondere Aktualität gewinnt. Selbstverständlich folgt aus der
oben angesprochenen Zwitterhaftigkeit von Sprache als Bedeutungsträger und
Klangkörper, dass die rhythmische Strukturierung der Sprache im Vers tief in
das syntaktische und somit Sinn-tragende Gefüge der Sätze eingreift. So
konturiert der Vers in seiner ästhetisch-rhythmischen, der artikulatorischen
Motorik erwachsenen Klangform, das natürliche Gefüge der durch Syntax und
Satzakzent vorgegebenen logischen Funktion von Sprache neu, ja deutet sie zum
Teil um. Die hierbei entstehenden neuen Wahrnehmungsmuster, in welchen alle
internen wie -externen Eigenschaften von Sprache verschärft bewusst und dadurch
neu bewertet werden, unterstreichen das der Lyrik zutiefst eigene Moment der
Untrennbarkeit von Form und Inhalt, von ästhetischer und sinnhafter Struktur.
Es entsteht in einem jeden Gedicht eine spezifische Form des rhythmischen
Pathos, der bis ins Extrem gesteigert werden kann in Oden oder freirhythmischen
Langzeilen, oder der sich in einer Annäherung an die Prosa beinahe bis zur
Unkenntlichkeit reduzieren lässt.
Stets ist - bis auf wenige Ausnahmen, welche die Regel bestätigen - der Vers
primär eine Gehörsgröße, obwohl diese natürlich im niedergeschriebenen
Gedicht zunächst als optische Größe erscheint. Und erst der gute Sprecher
wird das Gedicht im öffentlichen Vortrag modellierend zum Sprachkunstwerk
adeln. Die exakte Phrasierung, die bewusste Setzung von Sprechpausen, das
sinngeleitete Artikulieren und Akzentuieren macht das Gedicht erst zum Gedicht.
Und so plädiere ich nachdrücklich für die Lesung von Lyrik; aber ich
plädiere mit genauso großem Nachdruck für die rhetorische Schulung der
Sprecher, die Lyrik vorlesen. Gerade wenn Autoren ihre Gedichte selbst vorlesen,
fällt oftmals eine erstaunliche Diskrepanz zwischen Vortrag und Vorgetragenem
auf. Als ob dem Autor das Bewusstsein um sein Tun abhanden gekommen sei.
Bei aller Fertigkeit im Formalen und Inhaltlichen sowie in den Sagweisen ist
jedoch stets die Kenntnis der jeweiligen kulturellen Voraussetzungen eine
conditio sine qua non, eine unabdingbare Voraussetzung des
verantwortungsbewussten Umgangs mit Lyrik - sowohl beim rezeptiven
Interpretationsvorgang vorhandener, wie auch beim produktiven schöpferischen
Findungsprozess eigener Gedichte.
Und schon liegt er vor uns: der Werkzeugkasten des Lyrikers. Man könnte
meinen, ein gesunder Menschenverstand, eine hervorragende Literaturgeschichte
unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Lyrik in der Moderne, ein
Lexikon der Strophenformen, eine gute Metrik, ein Lehrbuch der Stilistik, ein
Lexikon der Symbole und Metaphern, sowie diverse Wörterbücher zur Aussprache,
Etymologie, Bedeutungskunde, sowie ein rückläufiges oder Reimwörterbuch und
natürlich noch einige Gedichtanthologien und als non plus ultra ein
vielbändiges Konversationslexikon reichten aus, und ein Lyriker ist geboren. -
Ach, beinahe hätte ich's vergessen: Federkiel und Pergament, Kugelschreiber und
Papier oder ein guter Computer mit einem Textverarbeitungsprogramm dürfen
natürlich nicht fehlen.
Ja! Mit Sicherheit ist die Kenntnis all der angesprochenen Hilfsmittel nicht
unnütz. Aber im Nachschlagen zeigt sich eben nicht der Meister. Eine Bindung
durch Bildung, wie es Goethe in seinem zitierten Sonett ausdrückt, ein inneres
Zusammenraffen, ein sich Beschränken und ein durch grundsolide Bildung
erworbenes Wissen um das Gesetz der Poesie geben dem Lyriker das notwendige
Werkzeug an die Hand. Alles weitere ist letzthin nicht erlernbar. Die zu
wählenden Stoffe, Motive, Inhalte, die Bilder, Metaphern und Tropen, die im
Gedicht benutzte Sprache mit ihren rhythmischen, syntaktischen und inhaltlichen
Valenzen muss ein jeder Lyriker selbst finden. Hier kann zwar der eine oder
andere Kunstgriff erlernt, vor dem einen oder anderen häufig begangenen Fehler
gewarnt und auf einige poetische Wertungslehren verwiesen werden - trotzdem ist
der Lyriker bei der Schöpfung seines Gedichtes ganz auf sich allein gestellt,
er muss einsam sein, er muss sich seine inhaltlichen Vorgaben selbst geben und
sie auch vor der literarischen Öffentlichkeit selbst verantworten. Er ist in
seinem Schaffen wie der dem einengenden Käfig endlich entronnene Wolf. Alles
andere wäre Anpassung an diktatorische Vorgabe oder populistische Anbiederung
an den Zeitgeist. Kaum einer hat so mit sich, mit seiner Zeit und der Sprache
gerungen, ja ist an diesem Ringen in der Hälfte seines Lebens zerbrochen und
hat die geborstene Leier frühzeitig, viel zu früh, abgeben müssen wie
Friedrich Hölderlin. Er warnt auf die ihm eigene Weise vor beiden Formen der
Unfreiheit in meisterhaften Distichen:
Falsche Popularität
O der Menschenkenner! er stellt sich Kindisch mit Kindern;
Aber der Baum und das Kind suchet, was über ihm ist.
und
Advocatus Diaboli
Tief im Herzen haß ich den Troß der Despoten und Pfaffen,
Aber noch mehr das Genie, macht es gemein sich damit.
und weil auch der folgende Text über den Lyriker und seine Stellung in der
Gesellschaft viel aussagt, ein weiteres Epigramm:
Guter Rat
Hast du Verstand und ein Herz, so zeige nur eines von
beiden,
Beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich.
Ich möchte Hölderlin, der sich dem Verdammungsurteil seiner Zeitgenossen
nicht entzogen und Herz und Verstand in Überfülle in seinem poetischen Werk
stets in engster Verschränkung präsentiert, nochmals zitieren, denn
prägnanter kann die populistische Anbiederung und das Wesen des dem
unversöhnlich gegenüberstehenden Dichterischen nicht in eine Odenform gegossen
werden:
Menschenbeifall
Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
Seit ich liebe? warum achtetet ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war?
Ach! der Menge gefällt, was auf dem Marktplatz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.
Im letzen Abschnitt meiner Ausführungen seien einige der angedeuteten
Konstituenten von Lyrik sowohl negativ wie positiv an wenigen, zum Teil noch
unveröffentlichten Gedicht-Beispielen von Poetae Minores unserer Zeit
erläutert.
Ich beginne mit einem publizierten Texte von Jürry W. Lenzen, einem
weitestgehend unbekannten Lyriker und Prosaisten, der im Raum Pforzheim als
Kunstmaler freiberuflich tätig ist:
Depression
Haus, das der Winde Preis,
verdammt mich und verzeiht!
Tod, du siehst mich bereit.
Haus, das im Blitz versinkt.
Satan erkennt sich nicht.
Seele, siehst du kein Licht?
Haus, das die Nacht verschlingt.
Narren Gespenster mich,
kriech blind zum Fenster ich.
Haus, wo der Schleier weht;
find ich im Zimmer nichts,
such ich den Quell des Lichts.
Haus, das im Schatten steht,
dunkel ist meine Welt,
die mir mein Haus vergällt.
oder auch:
Dunkel ist meine Welt,
die mir mein Haus vergällt,
Haus, das im Schatten steht.
Such ich den Quell des Lichts,
find ich im Zimmer nichts;
Haus, wo der Schleier weht.
Kriech blind zum Fenster ich,
narren Gespenster mich,
Haus, das die Nacht verschlingt.
Seele, siehst du kein Licht?
Satan erkennt sich nicht.
Haus, das im Blitz versinkt.
Tod, du siehst mich bereit,
verdammt mich und verzeiht!
Haus, das der Winde Preis.
Jürry W. Lenzen hat seine Lektionen gelernt. Rhythmisch, vom die Versgrenze
hervorhebenden Reimklang, von vokalischen Assonanzen her ist dieser Text bis auf
den qualitativ unmotiviert unreinen Reim Welt : vergällt und einige - auch
unmotivierte - rhythmische Abweichungen gelungen. Aber er geht gerade diesen
formalen Aspekten bei ihrer Erfüllung auf den Leim. Klang ist ihm wichtiger als
Inhalt, obwohl solch gewichtige Worte und Bilder wie Quell des Lichts, Seele,
Satan, Gespenster, Blitz, und das Bereitsein für den Tod, sowie das ganze Bild
des Menschen als eines Hauses nach Verantwortung schreien. Doch was sage ich,
über welchen der beiden Texte ist eigentlich zu reden. Hier ist das Dilemma mit
Blick auf die inhaltliche Tektonik, die Sukzession der Gedanken ganz
offensichtlich. Beliebigkeit tritt an die Stelle von Stringenz. Der erstgelesene
Text bringt bis auf kleinste Umstellungen in der Interpunktion und die beiden
korrekt wiedergegebenen letzten Zeilen den Text auf dem Kopf stehend, von hinten
nach vorne gelesen. Und wäre da nicht im an zweiter Stelle gelesenen Original
die formal wiederum gelungene Schlussbeschwerung des Textes durch das reimlose
Preis, das dem Reim bereit : verzeiht vokalisch assoniert, so würde die
Umstellung sicher auch bei genauerer Analyse kaum auffallen. Eine solche Probe
geht natürlich nur bei in strengem Zeilenstil und weitestgehend parataktisch
geformten Texten, also ohne sich über mehrere Verse hinziehende
syntaktisch-inhaltliche Passagen.
Ich komme zu einer 'lyrischen' Bestsellerautorin: Kristiane
Allert-Wybranietz, die neben mehreren Lyrikbändchen - beispielsweise mit
dem Titel "Trotz alledem" - und Märchen alle Autoren mit einem
Heyne-Ratgeber zum Thema "Wie finde ich den richtigen Verlag?"
beglückt hat. Ich nehme ein Beispiel ihrer lyrischen Potenz aus dem Bändchen
"Liebe Grüße", den neuen Verschenktexten, die allein von Oktober
1982 bis März 1983 sechs Auflagen erlebten, und sich weiterhin anhaltender
Beliebtheit erfreuen:
AN EINEN,
DEN ICH LIEBGEWONNEN HABE
Anfangs warst du ein Stern,
einer von vielen,
an meinem Himmelszelt.
Inzwischen bist du
ein Mond geworden
mit einerunheimlich starken
Anziehungskraft.
Man kann Lyrik mit dem Herzen, man kann sie mit dem Verstand machen, und im
besten Fall sind beide im Schaffensprozess unlösbar miteinander verwoben. Aber
mit dem Bauch kann Lyrik nie geschaffen werden, und das Resultat übermäßiger
Gefühlsblähungen konnten wir gerade hören. Hier stimmt nichts. Nicht einmal
das verlogen-falsche Gefühl. Weder Rhythmus noch Klang, weder Syntax (außer -
eher zufällig - in den drei Anfangszeilen) noch Inhalt geben uns einen Hinweis,
warum dieser Text in Versform auftritt. Dass zudem das Bild der Sterne und des
Mondes erstens romantisch verblasst, zweitens einen Standortwechsel des
lyrischen Ich erforderlich macht, drittens die Größen- und
Stärkenverhältnisse nicht stimmig sind und viertens die auf Menschen bezogene
Mondmetapher eher Lächerliches, wie Mann im Mond, Mondkalb oder Mondgesicht
assoziieren lässt, kommt bei diesem missglückten Text hinzu. Ein zweites
Beispiel soll dies nochmals unterstreichen:
LIEBESKUMMER
Der Apotheker
hat Tabletten
gegen Kopfschmerzen,
gegen Zahnschmerzen,
gegen Bauchschmerzen;
hat Tinkturen
gegen Ohrenschmerzen,
gegen Rückenschmerzen,
gegen Wundschmerzen;
hat Salben
gegen Muskelschmerzen,
gegen Gelenkschmerzen;
und
sieht ratlos aus,
als ich frage,
was er gegen meine Herzschmerzen
aufgrund chronischer Sehnsuchtempfehlen kann.
Hier erübrigt sich wohl jeder Kommentar, außer dem Hinweis, dass es für
alle Liebhaber der Satire einen köstlichen Anti-Wybranietz gibt: Tetsche's
Grüße "Trotz ... dem" Texte, die man sich schenken kann von Kristian
Ballert-Pyrowitz.
Eigentlich ist es der Autorin schon zuviel Ehre angetan, zwei Texte von ihr
zu verlesen. Es sei trotzdem noch ein Gedanke daran verschwendet. Wo Jürry W.
Lenzen formal gekonnt an seinen Bildern, seiner heren Sprache und dem
pseudo-romantischen Streben nach Verdunklung der Gedanken ins Beliebige
abgleitet, bringt Kristiane Allert-Wybranietz platt das Faktische aus ihrem
Gefühlsleben, spuckt es aus, und erfüllt damit eine Erwartungshaltung
verlogener Antworten in Tausenden von Frauenhirnen. Sie spielt mit den Problemen
von Vereinsamten, Enttäuschten, die ihr willig folgen. Und sie suggeriert damit
eine Geschmacksbildung, die völlig ahistorisch meint, Lyrik neu zu schaffen.
Weder ein Gefühl, noch ein Gedanke oder gar ein Zeitungsausschnitt sind
unvermittelt, ungestaltet Poesie.
Hierzu ein letztes Distichon Hölderlins, das uns überleiten soll zu vier
unbekannteren Autoren:
Die beschreibende Poesie
Wißt! Apoll ist der Gott der Zeitungsschreiber geworden
Und sein Mann ist, wer ihm treulich das Faktum erzählt.
Geben wir noch für wenige Minuten Apoll sein altes Recht und lassen wir -
von mir weitgehend unkommentiert - vier Autoren zu Wort kommen, die wenige von
ihnen kennen dürften, bei welchen ich jedoch alle voranstehend genannten
Bedingungen finde, ohne die Lyrik nicht auskommt, und die zudem in ganz
unterschiedlicher Traditionsverbundenheit eine meisterliche Sprachbeherrschung
und Gedankentiefe bzw. -schärfe aufweisen.
Ich gehe hierbei chronologisch vor und stelle zunächst den 1979 verstorbenen
homme des lettres Rijn Thaland vor, ein aus dem Expressionismus
hervorgegangener Lyriker besonderer Sprengkraft. Hier zwei Beispiele, die uns
durch ihre jeweilige Variation einen Schlüssellochblick in die Werkstatt des
Lyrikers gestatten:
Adagio
Der Wellen zart Gestreich
Sei dir noch scham und schade,
Schneefisch im Silberbade!
Aus deiner Perlen Jade,
Gestillt wie Mund im Laich.
Verwehr dem Weidenzweig
Gespinst und Fingerzeig!
Du halber Wonnen Lade
Und Seufzern Pfühl zugleich,
Gebogen und gerade
zu goldgebebtem Pfade
Blüh Rosen auf den Teich;
Fühl Ferne der Kaskade,
Geliebte, schwimm dich weich!
So Lippen nippen reich
Vom Leisen letzte Gnade.
Dasselbe im alten Stil
Der Wellen zart Gestreich
Sei dir noch scham und schade,
Herzlieb im Silberbade,
Ergrünt ein Mund von Laich
Des Leibs, der Glieder Jade
Wieg wie der Weide Zweig
Gespinst und Fingerzeig!
Gefrorner Wonnen Lade,
Tauseufzern Pfühl zugleich,
Gebogen schmilz gerade,
Schweig vorgebebter Pfade
Goldperlen auf den Teich;
Fühl ferne der Kaskade,
Schneehirtin, schwimm dich weich!
So Lippen nippen reich
Vom Leisen letzte Gnade.
Und - etwas weniger erotisch - das menschliche Gefühl der Vergänglichkeit
alles Seins, das zur Jahreszeit passt, reflektiert durch assoziationsreiche
Bilder darstellend, ein zweites Gedicht in Doppelform:
Tag der Mahd
Wald, geduckt vorm Turm der Wolken,
Berg, ergrimmt am Äthermeer,
Fackeln, die der Föhn aus Korn gemolken,
Glasten auf den Lehnen ernteschwer.
Wenn der See den Wälderodem,
Schleichend mit des Roggenmanns Begehr,
Schweiß des Bluts, geheimen Strohleibs Brodem
Eingehaucht der Inselflur, vermehr ..., vermehr.
Schauklerin des Schnitters, deiner Hüften
Sonne! Sonne! - Nimm den Mittag aus dem Winde,
Spiel das Gold aus Glas, schling gelb aus Lüften
Augentänze um die Totenlinde:
Bis der Schwarzen Rose Muschellippen
Nachtpupillen perlen in die Brust
Und vom Tau genetzte Wimpern nippen
Schleier auf den Blitz der letzten Lust.
Dasselbe im alten Stil
Wälder schwingen unter Wolken
Berge schwelln im Äthermeer;
Fackeln, die der Föhn aus Korn gemolken,
Glasten auf den Lehnen ernteschwer.
Wie der See dem Wäldermorgen
Städtefernen Frieden räderleer
Wie der Wind, in Blut und Milch geborgen,
Atem gab dem Herz der Flur, bescher ...
Einmal, schöner Tag, gewähr mir Goldes
Sonne; nimm den Mittag aus dem Winde,
Einen Mittag wie der Leisen holdes
Brunnenlied der breiten Wipfellinde:
Daß der Schwarzen Rose Sommerlippen
Reife Fenster brennen in die Brust
Und von den erstaunten Wimpern nippen
Letzte Schleier für des Auges Lust.
Rijn Thaland tritt hier als strenge Reim- und Strophenformen
bevorzugender Lyriker vor uns. Es ist eine hermetische Bilderwelt, die Worte
nicht leichtfüßig klingeln lässt, sondern sie überschwer belädt, sie in ein
mikrokosmisches innerliterarisches Beziehungsgefüge und eine makrokosmische
Traditionskette einbindet. Er hat auch ganz anderes geschrieben, stets ist es
aber Musik, melodiös rhythmisierte Sprache. Bis in die äußere Form auch von
Zyklen hinein sind seine Texte einem musikalischen Gestus verpflichtet. Die
wenigen Proben mögen jedoch genügen.
Ganz anders der 1918 in Hermannstadt geborene, erst 1988 nach Hamburg
ausgesiedelte Werner Bossert. Auch hier Abgeschlossenheit, jedoch weniger
in der Sinnfülle der Sprache und ihrer Bilder und Klänge, als in den
Möglichkeiten des Aussprechens. In der Hermetik der deutschen Literatur in
Rumänien, unter den Bedingungen der äußeren und inneren Zensur, die auch ihn
zum Verstummen brachten, ist in 12 Gedichtbänden eine Lyrikwelt ganz eigener
Prägung entstanden. Zunächst ein im Mai 1968 in Rumänien veröffentlichtes
Gedicht, das durch seine entgegengesetzten Bewegungsabläufe und den damit
korresponierenden Zeitformen, sowie die formale Gebundenheit und Klangstruktur
besticht:
Ararat
Nachdem es nun lange geregnet,
ersteige den Berg Ararat.
Hier fallen die Fluten,
hier lacht alles Land,
hier werden die Wege beginnen.
Thematisch verwandt durch das Bild des Ölzweigs und damit den Hinweis auf
die Arche Noah, und in seiner versteckten Kritik ähnlich indirekt wirkend, aber
doch sowohl inhaltlich wie formal völlig verschieden sein noch
unveröffentlichtes folgendes Gedicht:
Die Taube
Die, den Ölzweig nur im Schnabel,
über Schlamm und Fluten kam,
ach, wie lebt sie in der Fabel
und geht auf den Straßen lahm!
Bilderbuch und Bibelglaube
halten heilig ihren Flug.
Da die blinde liebe Taube
nie den Ölzweig wieder trug.
Wieder ganz anders der im Nordschwarzwald lebende Claus Küsters, den
ich mit zwei völlig gegensätzlichen Gedichten vorstellen möchte, die beide in
anderer Annäherung die oben angegebenen Kriterien von Vers und Rhythmus
ausschöpfen. Beim ersten Gedicht soll das Augenmerk oder besser das Ohrenmerk
auf den daktylischen Versgang gelenkt werden, dieses fließend-tänzerische
Spiel von Doppelsenkungen und seine Durchbrechung. Ich denke, der Beatles-Titel,
an welchen das Gedicht anknüpft, dürfte als bekannt vorausgesetzt werden.
Will you still feed me ... ?
Mein Kind, ich bin dir ergeben.
Du kamst grad zur rechten Zeit.
Du gabst, kleiner Mensch, mir das Leben,
Zukunft und Vergangenheit.
Da lagst du, stumm-schreiend, kein Wort;
bewegtest nur wirr deine Glieder.
So hilflos lagst du dort.
Da wußt ich: man braucht mich wieder.
Und kreuzweise tauschen später
die Rollen wir, du und ich.
Dein Wachsen. Ich sinke allmählich.
Jetzt, Kind, jetzt brauche ich dich.
Und ohne Titel ein teilweise der konkreten Poesie verpflichteter, bis an die
Grenzen der poetischen Möglichkeiten von Verssprache reichender Versuch:
gut
gut ist
gut ist der
gut ist der mensch
gut ist der mensch, nicht
gut ist der mensch, nicht naturgemäß
gut ist der mensch, nicht naturgemäß böse
ist der mensch, nicht naturgemäß böse
der mensch, nicht naturgemäß böse
mensch, nicht naturgemäß böse
nicht naturgemäß böse
naturgemäß böse
böse
Die Antinomie von gut und böse, der Streit um die Wertigkeit von Anlage und
Umwelt, von Vererbung und Sozialisation wird hier durch den einfachen Kunstgriff
der Montage und umgekehrten Demontage sinnfällig gemacht.
Als vierten Lyriker darf ich ihnen den Wildbader Eberhard Bechtle, der
jetzt knapp über dreißig Jahre alt wäre, hätte ihn nicht ein wohl auf unsere
atomar verseuchte Umwelt zurückzuführender, unheilbarer Blutkrebs
hinweggerafft. Er hat ein umfangreiches poetisches Werk hinterlassen, von
welchem bisher nur knappe Skizzen, von ihm Mikrogeschichten benannt,
veröffentlicht sind. Ich werde aus den von ihm gefundenen sechs Gedichtzyklen
zwei Einzeltexte auswählen (seine Mutter hat sie mir zur Verfügung gestellt),
die auch wiederum zwei ganz und gar unterschiedliche Seinsweisen von Lyrik
offenbaren. Er liebte Italien, er ist auf Sizilien begraben:
warum ich nach italien fahre
autos
campari
und junge italiener
verdi
vergil
via frattina
papa
pasta
piazza
und weil ich
ein
Deutscher bin
und als letzten, meine Ausführungen intuitiv illustrierenden Text, den
Moment des Erwachens, wie ihn Eberhard Bechtle in einem Sonett das durch
feine Durchbrechungen überkommener Vorgaben seinen rhythmisch-klanglichen Reiz
zieht, gestaltet hat, folgende Zeilen:
wenn am frühen Morgen schlafversunken
gleitet durch die Zeit im Dämmerlicht
heller Leib und dunkelndes Gesicht
unter Brückenbögen weißer Stunden
ist er so sehr in seinem Ruhen fern
so sehr daß er mit seinem Rufen
ihn nicht erreicht und sinnlos suchen
seine Augen den verlornen Kern
bis mächlich strömt in unsichtbarem Fächeln
ein Lufthauch über reine stille Weiden
des Traumes uferlosen Sumpf
durchbricht und wandelt zu Triumph
was vorher noch ein dunkles Scheiden
und steigt aus schattenlosem Mund sein Lächeln.
Ich komme nach diesen Beispielen gelungener Lyrik, die erkennen lassen, dass
es hier Menschen unterschiedlichster Herkunft, Lebenserfahrung und
Lebenseinstellung ernst ist mit dem Schreiben, dass ihnen Sprache in lyrischer
Gestaltung stets Apoll geweiht ist, zum Schluss.
Orpheus, dem ersten Sänger, dem ersten Lyriker des Mythos, sollte
nacheifern, wer Gedichte schreiben möchte.
Zu guter Letzt noch - sowohl kopfschüttelnd wie auch augenzwinkernd in
strenger Sonettform - das Sediment meiner Anmerkungen, wie es gut zentrifugiert
Siegfried Carl im Wort-Labor erstellt hat:
Lyrik heute (Kopfschüttelnd 2)
'Wer Lyrik sagt, meint heute häufig Lallen,'
liebt Reim und Wohlklang und sonst weiter nichts,
meint, daß der breiten Menge Wohlgefallen
am schönen Schein sei Adel des Gedichts.
Noch gräßlicher das Aufeinanderprallen
von bauchigem Gefühl mit reinem Nichts.
Ich denke, solche werdens niemals schnallen,
daß dies der Tod ist jeglichen Gedichts.
Gedichte sind nur sprachliche Verdichtung,
Sprachlosigkeit zu hauen eine Lichtung
im Dickicht aller Nur-Geschwätzigkeit.
Gedichte weisen weisen Menschen Richtung,
sind Widerpart unmenschlicher Vernichtung
und klären Tod und Einsamkeit und Streit.
Ich danke ihnen fürs geduldige Zuhören.
Nachbetrachtung
Bewusst wurde dieser aus dem Jahr 1991 stammende Vortrag -
gehalten vor Lyrikerinnen und Lyrikern aus dem deutschsprachigen Raum - hier
ohne Änderungen, d.h. wie damals gehalten, abgedruckt. Damals schloss sich an
diesen Vortrag ein mehrstündiger WorkShop in "Kreativem Schreiben"
an, in dem viel im Vortrag nur Angerissenes praktisch vertieft werden konnte.
Heute würde Manches sicherlich anders gesagt, bei den
Beispielen, bei deren Auswahl auf damalige Bedingungen Rücksicht genommen
wurde, die eine oder andere Nuance umformuliert.