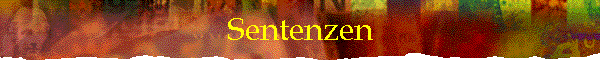Sentenzen

Herkunft der Sentenzen
carpe
diem
„pflücke
den Tag“,
d.h.
lass ihn nicht ungenützt vorüber;
nutze den Tag, epikureische
Weisheit, wonach jeder Tag als Geschenk der Götter zu genießen sei;
Vergangenem solle man nicht nachtrauern und über Bevorstehendes nicht grübeln.
bei
Horaz, Oden I, 11, 8
memento mori
„gedenke des Todes“,
d.h. denke stets daran, dass du sterblich bist;
mittelalterlich,
Wahlspruch des Kartäuserordens.
alea
iacta est
„der
Würfel ist gefallen“,
geht
auf einen Vers des Menandros zurück, der zum Sprichwort wurde: „Der Würfel
sei empor geworfen“ im Sinn von „die Sache ist beschlossen“.
Caesar
soll das Sprichwort in griechischer Sprache ausgesprochen haben, als er am 10.
Januar 49 v. Chr. den Rubicon überschritt und damit den Bürgerkrieg einleitete
– wie Pluarch, Pompeius 60,
berichtet.
Die
Aussage beinhaltet nicht die Entscheidung Caesars, sondern nur die Erkenntnis,
dass eine Entscheidung gefallen ist, die man aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht kennt. Dies kommt daher, dass der Würfel in einem Würfelbecher
gefallen ist, der Becher jedoch noch nicht hochgehoben wurde.
Bei
Sueton, Divus Iulius 32 heißt es:
„iacta alea est“
– „Geworfen
ist der Würfel!“.
errare
humanum est
„Irren
ist menschlich“,
lateinisches
Sprichwort, nach Cicero, Philippica XII, 2, 5 u. a.
tertium
non datur
„ein
Drittes gibt es nicht“,
lateinischer
Ausdruck der Logik, der gemeinhin als Satz vom ausgeschlossenen Dritten bezeichnet
wird. Der Satz basiert auf dem sog. Zweiwertigkeitsprinzip, nach dem alle Sätze
entweder falsch oder wahr sind. Bei Aristoteles heißt es schon:
„Soviel
sei nun darüber gesagt, dass die Meinung, entgegen gesetzte Aussagen seien
nicht zugleich wahr, die sicherste von allen ist; [...] Da es aber unmöglich
ist, über ein und dasselbe zugleich Widersprechendes mit Wahrheit auszusagen,
ist es offenbar, dass nicht ein und demselben zugleich Gegenteiliges zukommen
kann. [...] Wenn es also unmöglich ist, etwas mit Wahrheit gleichzeitig zu
bejahen und zu verneinen, so ist es auch unmöglich, dass Gegenteiliges zugleich
demselben zukomme, es sei denn, dass entweder beide Gegenteile nur in gewisser
Beschränkung zukommen oder das eine nur in gewisser Beschränkung, das andere
aber schlechthin. Und doch ist es nicht möglich, dass ein Mittleres zwischen
den beiden Gliedern des Widerspruches gibt, sondern man muss eben eines von
beiden, entweder bejahen oder verneinen.“
(Aristoteles,
Metaphysik 1011b, 13ff.)